Handschriften gehören zu den faszinierendsten
Objekten, die sich aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit erhalten haben.
Eine besondere Bedeutung erlangen sie im Humanismus, da die Humanisten ein
besonders enges Verhältnis zum Buch hatten. Die Vorlesung stellt berühmte
Codices aus der Zeit vom 14. bis zum frühen 16. Jahrhundert im humanistischen
Kontext vor und erläutert, warum sie für die grundwissenschaftliche und auch
generell für die mediävistische bzw. Humanismus-Forschung so wichtig sind und
worauf ihre Bekanntheit fußt (Buchschmuck, Inhalt, Besitzgeschichte und spätere
Verwendung der Handschrift etc.). Auf diese Art und Weise sollen bestimmte
Aspekte der humanistischen Kultur anhand dieser Objekte exemplarisch behandelt
werden.
- Enseignant: Martin Wagendorfer
Wissentlich verbreitete Falschmeldungen dienen der
politischen Propaganda, sind gezielte Strategie der Desinformation und
beeinflussen politische Entscheidungen. Nicht nur die Gegenwart, auch das
Mittelalter bietet zahllose Beispiele für den manipulativen Umgang des Menschen
mit dem Wahrheitsbegriff. Wie lässt sich mit Hilfe der grundwissenschaftlichen
Disziplinen der Diplomatik, Paläografie, Sphragistik und Chronologie die
Authentizität historischer Quellen überprüfen? Was war die Motivation der
mittelalterlichen Fälscher? Und was passierte mit Fälschern, sofern deren Tun
überhaupt zeitnah entdeckt wurde? Die Übung bietet unter anderem die
Möglichkeit, anhand der Erkenntnisse der großen Regesten-Werke (Regesta
Imperii) und kritischen Urkunden-Editionen (MGH) Fälschungsmerkmale an vorgeblichen
Kaiser- und Königsurkunden nachzuvollziehen. Gelesen werden vor allem Urkunden,
aber auch Gerichtsprotokolle.

- Enseignant: Susanne Wolf
Ü Die Latinität des Mittelalters und der Frühen Neuzeit - Eine Einführung mit Lektüreübungen (09126)
Die lateinische Sprache, in der die meisten
mittelalterlichen und auch viele neuzeitliche Quellen abgefasst sind, stellt
erfahrungsgemäß eine gewisse Hemmschwelle bzw. Eingangshürde bei der
Beschäftigung mit diesen Quellen dar, zumal typisch mittelalterliche Quellen
wie Urkunden oder hagiographische Texte auch eine eigene Herangehensweise
verlangen. Die Lehrveranstaltung hat das Ziel, diese Hemmschwelle abzubauen und
in den adäquaten Umgang mit diesen Quellen einzuführen. Zunächst soll ein
kurzer Überblick über die Geschichte der Disziplin Mittel- und Neulatein
gegeben werden, anschließend werden die wichtigsten Hilfsmittel für die
Übersetzung lateinischer Quellen sowie ihre richtige Benützung vorgestellt. Im
Hauptteil der Veranstaltung sollen dann gemeinsam exemplarische Texte gelesen
werden, an denen die Eigenheiten des mittelalterlichen und neuzeitlichen Latein
sowie bestimmter Quellengattungen aufgezeigt werden sollen.
- Enseignant: Martin Wagendorfer
Als Alexander „der
Große“ 323 v. Chr. starb, hinterließ er seinen Heerführern ein Weltreich nie
zuvor gesehenen Ausmaßes. Auf dessen Boden etablierten sich nach Alexanders
Tod, infolge der sog. Diadochenkriege, die hellenistischen Nachfolgereiche – eines
davon war das Reich des Ptolemaios in Ägypten. Ptolemaios legte die Grundlage
für eine griechisch-makedonische Herrscherdynastie, die bis zur Eroberung
Ägyptens durch Octavian/Augustus im Jahre 30 v. Chr. Bestand haben sollte. Die
letzte Herrscherin dieser Linie war Kleopatra VII., die berühmte „Kleopatra“.
In diesen knapp dreihundert Jahren zog es zahlreiche Griechen und Makedonen
(und andere) in das Land am Nil. Griechische und ägyptische Kultur
beeinflussten sich gegenseitig. Die Ptolemäer wurden als Pharaonen verehrt und
doch soll Kleopatra, die letzte dieser Dynastie, die erste ihrer Linie gewesen
sein, die des Ägyptischen kundig war. Das neugegründete Alexandria wurde eines,
wenn nicht das kulturelle Zentrum der griechischen „Oikoumene“ im Mittelmeerraum.
Das Griechische wurde Verwaltungssprache (und blieb dies knapp 1000 Jahre lang,
noch unter römischer Herrschaft). Manche Ägypter lasen Homer und gaben sich griechische
Namen. Können wir hier von einer „Mischkultur“ (Droysen) sprechen oder lassen sich
diese Verhältnisse doch eher in Richtung von „Parallelgesellschaften“
interpretieren?
In der Übung werden wir einerseits den politischen Hintergrund der Entwicklung des Ptolemäerreiches, vor allem dessen Beziehungen zum griechischen Mutterland, den anderen alexandrinischen Nachfolgereichen und zuletzt mit Rom untersuchen. Andererseits werden wir uns aber vor allem dem Alltagsleben jener Epoche zuwenden, was nicht zuletzt durch den Umstand möglich wird, dass sich in Ägypten die Papyri erhalten haben, die uns nicht von der großen Politik, sondern ganz unmittelbar von Angelegenheiten des täglichen Lebens berichten. Der Einfluss griechischer Kultur und Institutionen ermöglicht uns somit auch den Blick auf Prozesse, die ähnlich auch in anderen griechisch geprägten Regionen des Mittelmeerraumes abgelaufen sein müssen, von denen wir von dort aber kaum Kenntnis haben. So präsentiert sich uns das ptolemäische Ägypten in einer Vielschichtigkeit und Eindringlichkeit, wie sie in der antiken griechischen Welt sonst beispiellos sind.
Thematisch wird das Leben der Griech:innen (und Makedon:innen) sowie der großen Mehrheit der Ägypter:innen unter griechisch-makedonischer Herrschaft im Zentrum stehen. Hierbei werden Fragen nach der hellenistischen Herrschaftspraxis durch Verwaltung, Militär und Justiz ebenso behandelt wie solche nach dem Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungs- oder Statusgruppen und kulturellen Transferprozessen, der Beziehung zwischen Staat und Individuum, wirtschaftlichen Prozessen sowie sozialen Strukturen.
Methodisch im Zentrum stehen die Lektüre und Interpretation papyrologischer Quellen, der Umgang mit papyrologischen Editionen, Kommentaren und Datenbanken sowie die Diskussion historisch-papyrologischer Fachliteratur.
Altsprachliche Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt; vielmehr möchte die Übung gerade auch vermitteln, dass und wie man auch ohne Griechischkenntnisse aus papyrologischen (und anderen) Quellen Nutzen ziehen kann.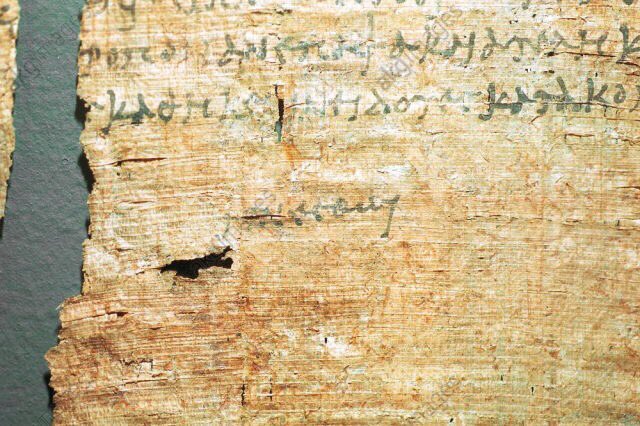
- Enseignant: Matthias Stern
Die Veranstaltung soll einen Überblick über die Kaiser- und Königsurkunden der „deutschen“ Herrscher im Früh- und Hochmittelalter geben. Im Mittelpunkt der Übung stehen hierbei – nach einer kurzen Einführung in die Diplomatik (Urkundenlehre), eine der grundlegenden Disziplinen der Historischen Grundwissenschaften, – die lateinischen Urkunden, beginnend mit den merowingischen Königsurkunden, den Zäsuren unter Ludwig dem Deutschen, der weiteren Entwicklung unter den Ottonen, Saliern bis hin zu den Urkunden der Staufern, ihr Erscheinungsbild (äußere Merkmale), ihre Bestandteile (innere Merkmale) und natürlich auch die Kanzlei, die für die Erstellung der Urkunden zuständig war.
Des Weiteren befassen wir uns mit der Frage: was steht in diesen Dokumenten? Hierzu ist die Bereitschaft sich auf ein fremdes Schriftbild einzulassen dringend erforderlich; um die Inhalte der Urkunden zu verstehen, sind darüber hinaus (Grund-)Kenntnisse in Latein mehr als hilfreich, vor allem, da wir die Urkunden lesen (transkribieren) und übersetzen werden!
Abschließend widmen wir uns der heutigen Bearbeitung von Urkunden: wie werden diese mittelalterlichen Quellen jetzt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht? Wie werden sie bearbeitet? Am Ende des Semesters ist zusätzlich ein Besuch im Bayerischen Hauptstaatsarchiv geplant.
- Enseignant: Franz Bornschlegel
- Enseignant: Kathrin Gutermuth
Die karolingischen Kapitularien belegen deutlich die münzpolitischen Absichten der Herrscher und deren Handeln auf diesem Gebiet. Die Münzfunde sind eine Quellengattung, die uns darüber Auskunft geben kann, ob dieses absichtsvolle Handeln Erfolg hatte.
Auf der Grundlage dieser beiden Quellengruppen werden wir uns damit auseinandersetzen, welches Bild die heutige Forschung vom Geldwesen der karolingischen Epoche gewonnen hat.
- Enseignant: Franz Bornschlegel
- Enseignant: Hubert Emmerig
Die noch junge Wissenschaft der mittelalterlichen
und neuzeitlichen Epigraphik hat innerhalb der letzten 25 bis 30 Jahre eine
rasante Entwicklung erfahren, die sich im eifrigen Ausbau der europaweiten
Editionen der Quelle Inschrift in nationalen Inschriftencorpora sowie in zahlreichen
schrift- und formularkundlichen Untersuchungen niederschlug. Trotz vielfältiger
in- und ausländischer Aktivitäten bleibt die Erstellung einer
gesamteuropäischen Epigraphik für viele Inschriftenarten weiterhin ein
Desiderat der Forschung. Die Vorstellung eines einheitlichen
Entwicklungsverlaufes von Schrift und Formular, wie er über weite Strecken im
deutschen Sprachraum nachzuvollziehen ist, muss aus gesamteuropäischer Sicht
nicht selten modifiziert und korrigiert werden. Die an epigraphisch
Fortgeschrittene gerichtete Veranstaltung beschäftigt sich mit den
„Brennpunkten“ der epigraphischen Forschung und den Möglichkeiten und Grenzen
der regionalen und zeitlichen Einordnung von Inschriftendenkmälern anhand epigraphischer
Methoden.
- Enseignant: Franz Bornschlegel
Im Lektürekurs innerhalb des Master-Studiengangs
lesen die Studierenden selbständig wissenschaftliche Literatur, die zu den
Grundlagenwerken des Faches gehört oder einen besonderen Einfluss auf die
Forschung ausgeübt hat. Die Auswahl der Titel erfolgt in Absprache mit dem
Dozenten in der ersten Sitzung; in einer Zwischenbesprechung gegen Mitte des
Semesters können etwaig auftretende Fragen oder Probleme erörtert werden; in
der mündlichen Prüfung am Semesterende wird die Lektüre diskutiert.
- Enseignant: Martin Wagendorfer
Im ersten Teil der Veranstaltung sollen die schriftlichen Zeugnisse des Mittelalters allgemein kategorisiert, methodisch erfasst und im zeitlichen Wandel betrachtet werden. Er dient der Einführung in die Grundbegriffe, Arbeitsmethoden und Hilfsmittel der Historischen Grundwissenschaften, die sich aus etablierten wie jungen Forschungszweigen zusammensetzen. Jedes Fach ist für sich autonom und erfordert eigene Fragestellungen und Methoden. Der Kurs beschäftigt sich mit der Diplomatik (Urkundenlehre) und der Paläographie (Lehre der Entwicklung der lateinischen Schrift), die zu den klassischen Disziplinen der Historischen Grundwissenschaften zählen und den Schwerpunkt des Basiskurses bilden. Ferner gilt die Betrachtung den eng mit diesen Kernfächern in Zusammenhang stehenden Forschungsbereichen Chronologie (Zeitrechnungslehre), Sphragistik (Siegelkunde) sowie der an der hiesigen Abteilung besonders gepflegten, jungen Disziplin der Epigraphik (Inschriftenkunde) des Mittelalters und der Neuzeit.
Im zweiten Teil der Veranstaltung stellen ausgewählte Schriftzeugnisse aus der Stadt Augsburg die Referatsthemen, die nach allgemein historischen wie grundwissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten sind.- Enseignant: Franz Bornschlegel
Im Oberseminar wird über den Stand der laufenden
Bachelorarbeiten, Master-/Magister-arbeiten und Dissertationen berichtet; zudem
stellen Mitarbeiter und auswärtige Kollegen ihre Projekte vor. Geplant
sind außerdem zwei Ein-Tages-Exkursionen. Die Termine werden in der ersten
Sitzung noch bekannt gegeben.
- Enseignant: Franz Bornschlegel
- Enseignant: Martin Wagendorfer
Ziel der Lehrveranstaltung ist die Erschließung und
Aufarbeitung eines bisher noch nicht bearbeiteten Nachlasses eines vor allem
auf hilfswissenschaftlichem Gebiet tätigen Mediävisten aus der Zeit um 1900.
Dabei sollen hilfswissenschaftliche Methoden wie Regesten- und Editionstechnik
geübt werden. Vorgesehen sind zwei eintägige Exkursionen, um Arbeiten an den
Originalen zu ermöglichen (die Termine werden in der ersten Sitzung mitgeteilt).
- Enseignant: Martin Wagendorfer