- Enseignant: Charlotte Bank
- Enseignant: Ilse Sturkenboom
Anfang der 1970er Jahre stellte die Kunsthistorikerin Linda Nochlin die berühmte Frage: „Warum hat es keine großen Künstlerinnen gegeben?“. Diese Fragestellung hat die Kunstgeschichte maßgeblich geprägt und zu einer kritischen Revision des Kanons geführt. Insbesondere im Bereich der Skulptur, der traditionell stark von männlichen Kunstschaffenden dominiert wird, erweist sich die Aufdeckung weiblicher und queerer Beiträge als eine noch komplexere, aber umso dringlichere Aufgabe.
Dieses Seminar widmet sich der Erforschung der Geschichte weiblicher und queerer Kunstschaffender in der Bildhauerei, mit besonderem Schwerpunkt auf der Moderne und Gegenwartskunst. Der Fokus liegt dabei auf der künstlerischen Ausbildung und Arbeit von Bildhauer*innen aus dem globalen Süden, deren Werke oft übersehen oder marginalisiert wurden. Von Pionierinnen wie Edmonia Lewis (USA), Harriet G. Hosmer (USA) und Augusta Savage (USA) über Künstlerinnen der Moderne wie Anna Maria Maiolino (Brasilien), Senga Nengudi (USA) und Doris Salcedo (Kolumbien) bis hin zu Füsun Onur (Türkei) werden auch zeitgenössische Positionen vorgestellt: Jüngere und zugleich wegweisende Figuren wie Bharti Kher (Indien/Großbritannien), Araya Rasdjarmrearnsook (Thailand), Peju Alatise (Nigeria), Huma Bhabha (Pakistan/USA), Nandipha Mntambo (Südafrika) und Arantxa Etcheverria (Frankreich/Venezuela) werden im Seminar behandelt, um die vielfältigen Strategien aufzuzeigen, mit denen diese Künstler*innen Themen wie Migration, Identität, Geschlecht und kulturelle Hybridität in ihren Werken verhandeln.
Die doppelte Marginalisierung – als Frauen und/oder queere Identitäten in einem männlich konnotierten Kunstfeld und als Kunstschaffende aus nicht-westlichen Kulturen – erfordert eine differenzierte Betrachtung. Daher werden im Seminar postkoloniale Theorien sowie gender- und queertheoretische Ansätze zur Anwendung kommen. Diese Methoden sollen dazu beitragen, aus dem westlichen Kanon ausgeschlossene Kunstschaffende wieder ins Zentrum der Diskussion zu rücken. Durch Referate und Close Reading sollen die Teilnehmer*innen lernen, methodische Ansätze zu verfeinern und Themen zu bearbeiten, die bisher am Rande der Kunstgeschichte standen. Dabei werden aktuelle internationale Projekte berücksichtigt, die eine „Revision des Skulpturenkanons und Erweiterung medienspezifischer Termini“* kritisch einfordern.
Dabei werden aktuelle internationale Projekte berücksichtigt, die eine „Revision des Skulpturenkanons und Erweiterung medienspezifischer Termini“ kritisch einfordern.*
Aktuelles internationales Skulpturenprojekt:
*SKULPTUR 1900 - 2000 – EINE QUE(E)RSCHNITTSGESCHICHTE: ZUR REVISION DES SKULPTURENKANONS UND ERWEITERUNG MEDIENSPEZIFISCHER TERMINI
Website: https://www.hbk-bs.de/hochschule/mitarbeiterinnen/dr-ursula-stroebele/skulptur-1900-bis-2000/
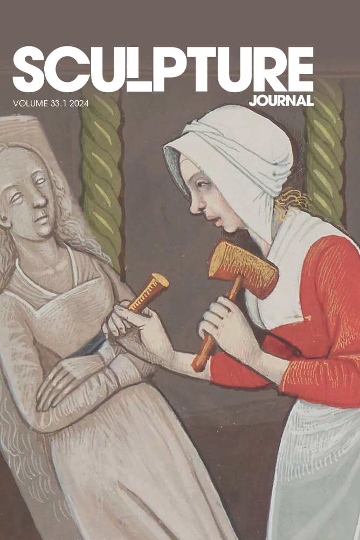
Robinet Testart, Marcia , 1488-96, Pergamentpapier , in Giovanni Boccaccio, Des celere et nobles femmes, Paris, Bibliothèque Nationale de France , ms fr. 59, fol. 58r, photo: gallica.bnf.fr/ BNF)
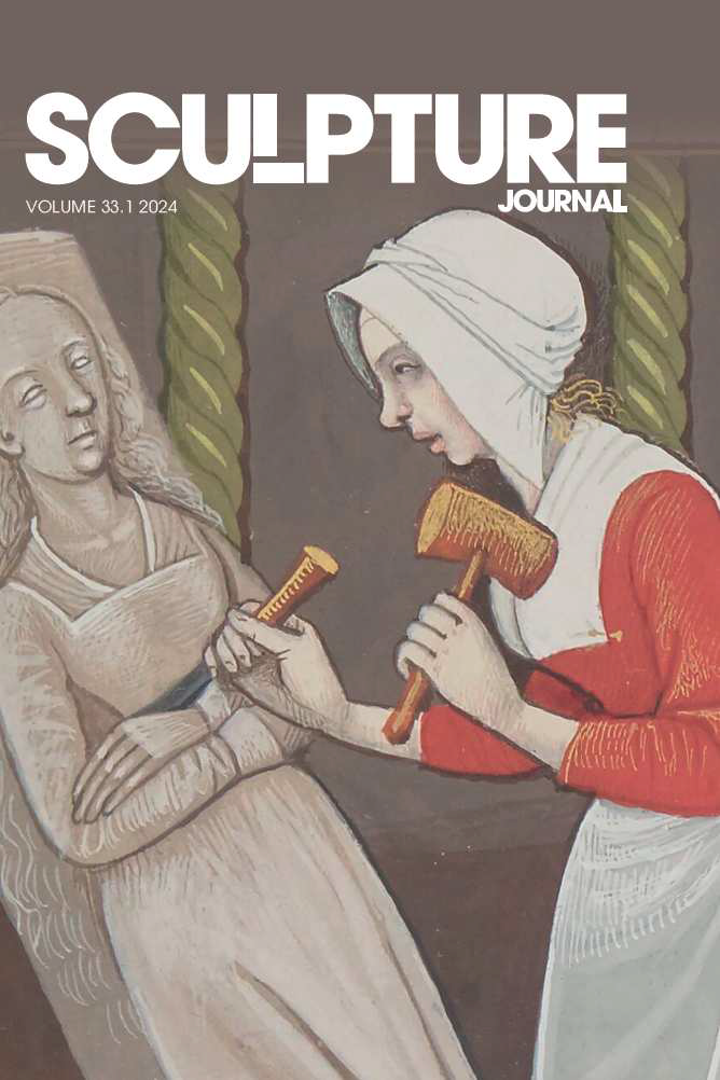
- Enseignant: Buket Altinoba
Die Barocke Wand- und Deckenmalerei vereint aufgrund ihrer allgemeinen
Verbreitung und Großflächigkeit wie kaum ein anderes Medium die
unterschiedlichsten Facetten frühneuzeitlicher Malerei. Fragen zur
Ausbildung und Werkstattorganisation von Freskanten, der
Auftraggeberschaft, Technik, Perspektive, Ikonografie und Bildrhetorik
können anhand unterschiedlicher Objekte vom 16. bis in 18. Jahrhundert
methodisch weiterführend aufgezeigt werden. Das Seminar, das sich an
Anfänger und Fortgeschrittene richtet, möchte darüber hinaus ein
grundlegendes Verständnis für das wissenschaftliche Erarbeiten
ikonografischer Fragenstellungen vermitteln.
- Enseignant: Angelika Dreyer
- Enseignant: Yannis Hadjinicolaou
- Enseignant: Sophie Junge
Erwartet wird die Bereitschaft zur regelmäßigen, aktiven Teilnahmen und die Lektüre von Texten in deutscher und englischer Sprache.

- Enseignant: Henry Kaap
- Enseignant: Ulrike Keuper
Großformatige Tapisserien gehören zu den kostspieligsten Objekten, mit denen vom späten Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit ganze Räume und Fassaden temporär umfassend ausgestattet und verändert werden konnten. Der Zeitaufwand bei Herstellung der Bildwirkereien als auch die verwendeten Materialien machten Tapisserien zur Luxusware, die der Wand- und Tafelmalerei der Zeit nicht selten den Rang abliefen. Die u. a. in Aubusson, Tournai oder Brüssel produzierten Werke waren in ganz Europa begehrt. Viele Höfe nutzten das prestigeträchtige Medium, um mit den darauf dargestellten Geschichten auch politische Signale zu vermitteln. So treten hier zunächst die burgundischen Herrscher hervor, die sich durch beträchtliche Investitionen in die mobilen Bildwirkereien (etwa zu Alexander dem Großen oder Julius Caesar) bei Festen und Einzügen eine Kulisse für ihr politisches Wirken schufen. Doch auch literarische Themen, Wappen, biblische Erzählungen wurden in aufwendige Tapisserien umgesetzt, die Sammlerbegehrlichkeiten in ganz Europa weckten.
Das Seminar, das sich an Anfänger und Fortgeschrittene richtet, wird sich an ausgewählten Beispielen dem Medium Tapisserie widmen. In gemeinsamen Lektüren in den ersten Sitzungen sollen die methodischen Grundlagen erarbeitet werden.
- Enseignant: Cornelia Logemann
Im Mittelpunkt des Seminars steht die schillernde Welt der Fabelwesen in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kunst. Anhand ausgewählter Kunstwerke untersuchen wir Gestalten wie das Einhorn, den Basilisken, Drachen und andere Mischwesen, die zwischen Mythos, Naturvorstellung und moralischer Allegorie changieren. Dabei stehen sowohl ikonographische als auch kulturgeschichtliche Fragestellungen im Vordergrund. Wir verfolgen die Wege dieser Wesen durch Handschriften, Tafelbilder, Wandmalereien und Objekte.
Das Seminar richtet sich an Studienanfänger:innen und vermittelt parallel die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens. Dazu gehören der Umgang mit Literatur, das Verfassen kurzer schriftlicher (Seminar-)Arbeiten sowie erste Recherchestrategien. Ziel ist es, Methoden kunsthistorischer Analyse an einem charakteristischen Thema praktisch zu erproben. Die Bereitschaft zur aktiven Teilnahme wird vorausgesetzt.
Geplant ist der gemeinsame Besuch der Ausstellung 'Einhorn - Das Fabeltier in der Kunst' im Museum Barberini im Potsdam (voraussichtlich Anfang Januar).

- Enseignant: Gabriele Wimböck
- Enseignant: Joanna Olchawa
- Enseignant: Matilde Cartolari
- Enseignant: Charlotte Bank
Die Vorlesung gibt entlang von zentralen Kunstorten, Bauwerken,
Künstlern ein Einführung in die sakrale Deckenmalerei. Berücksichtigt
werden die Ikonographie, der Stil, formale Qualitäten und das für die
Deckenmalerei konstitutive Verhältnis zwischen Bild und Raum. Die
Vorlesung kann dabei aus eine reichen Forschungstradition und einer
Fülle an überlieferten Denkmälern in Europa schöpfen. Themen wie die
Konfessionalisierung, das Verhältnis zwischen Glauben und Wissen,
Naturwissenschaftliche Erkenntnissen und Glaubenwahrheit, Sakralraum und
Aufklärung sollen zur Sprache kommen. Die sakrale Deckenmalerei stellt
dabei eine Kunstform mit einem besonders hohen Grad von 'Öffentlichkeit'
dar, da diese Räume mit die zugängstlichen Räume in der Frühen Neuzeit
waren. Das Verhältnis zwischen christlichen und antik-heidnischen
Sakralräumen wie auch das Verhältnis zu Sakral- und Kulträumen wie auch
Versammlungsräumen anderer Religionen oder religiöser Praktiken werden
vereinzeilt in den Blick kommen, das Hauptaugenmerk wird aber auf das
Christentum in Europa gelegt.

- Enseignant: Matteo Burioni


