Antike Eliten stehen seit langem im Fokus der althistorischen Forschung – und bleiben gleichwohl eines der umstrittensten Forschungsthemen des Fachs. Das liegt am besonderen Charakter der Verfassung antiker Gesellschaften als von ihren Bürgern selbst regierten Stadtstaaten. Wie in allen vormodernen agrarischen Gesellschaften akkumulierte die Mitglieder der Oberschicht in Griechenland und Rom zwar die meisten materiellen Ressourcen und genossen den größten politischen Einfluss und das höchste soziale Ansehen. Sie bildeten allerdings keinen erblichen Adelsstand und sahen sich in ihren Führungsansprüchen ständig mit einer sozial breiten Bürgerschaft konfrontiert, die von den Mitgliedern der Elite gemeinnützige Leistungen und eine Achtung ihrer Freiheitsrechte verlangten. Hinzukommt, dass antike Eliten keineswegs statisch waren: Der Wandel der politischen Institutionen hatte immer Rückwirkungen auf die Rekrutierung, Reproduktion und Legitimation der gesellschaftlichen Oberschicht: zwei einschneidende Umbrüche dieser Art waren die Entstehung der Polis im archaischen/frühklassischen Griechenland und der Übergang vom oligarchischen Regiment der Senatoren zur imperialen Alleinherrschaft der Kaiser in der römischen Welt.
Im Lektürekurs nähern wir uns den wichtigsten Fragen der althistorischen Eliten-Forschung anhand ausgewählter neuer Forschungsbeiträge zu den Eliten im archaischen Griechenland, der späten Republik und der römischen Kaiserzeit. In Auseinandersetzung mit ihren revisionistischen Thesen werden wir diskutieren, welche methodischen Probleme der Erforschung antiker Eliten eigen sind und welche soziologischen Theorien und epochenübergreifende Kulturvergleiche dabei zum Einsatz kommen (sollten).
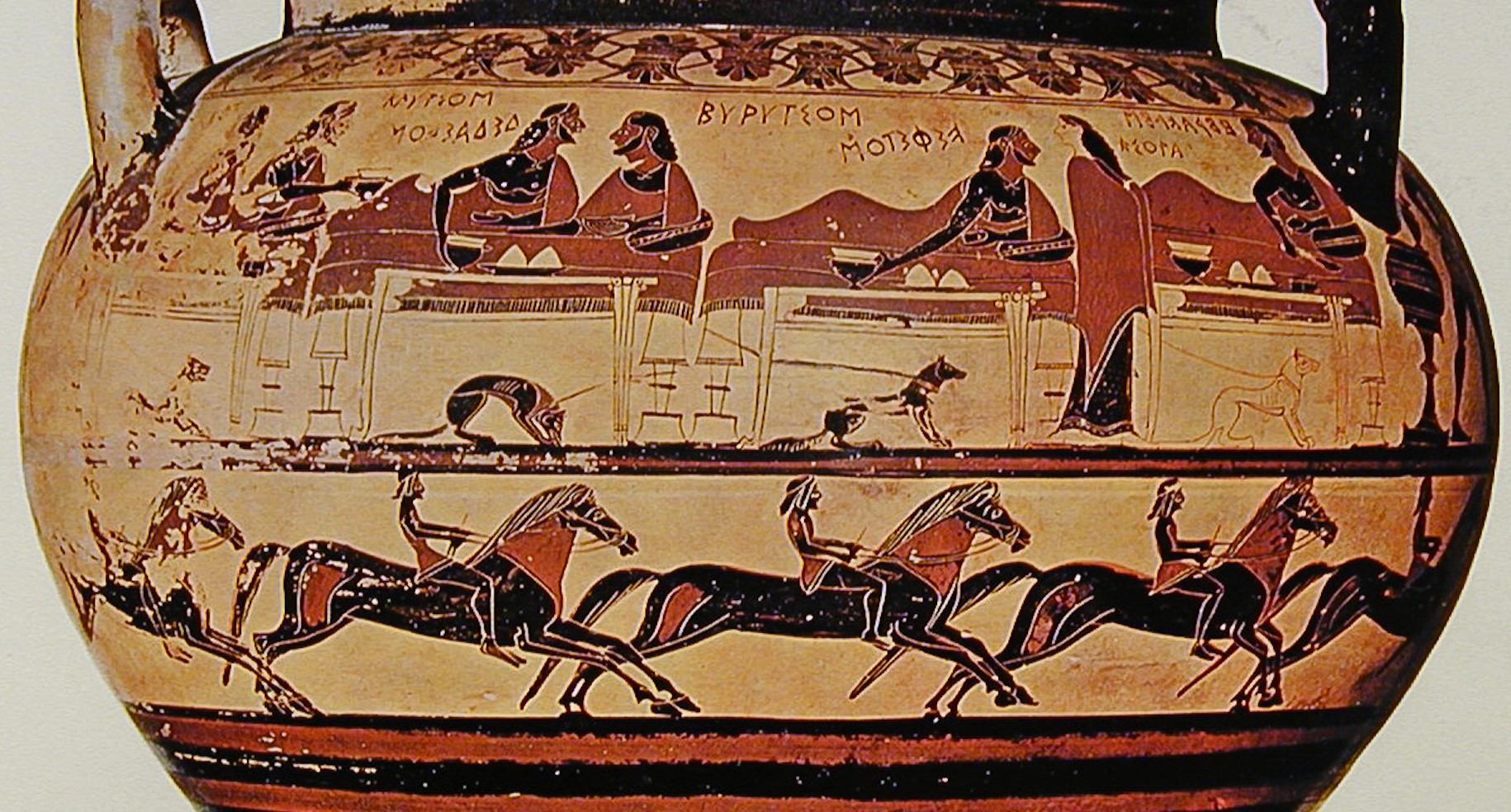
- Trainer/in: Moritz Hinsch