Während
des gesamten Mittelalters waren Urkunden ein zentrales Mittel zur Ausübung von
Herrschaft. Mit Urkunden konnte der Herrscher beispielsweise seinen
Untergebenen Rechte und Privilegien gewähren, ihnen Befehle erteilen,
Gerichtsurteile fällen oder Erklärungen über geltendes Recht abgeben. Dafür bot
sich vor allem im Spätmittelalter eine Vielzahl an verschiedenen Formen an: Vom
reich verzierten feierlichen Privileg auf kostbarem Pergament bis hin zum fast
schmucklosen Brief auf einem Papierzettel. Die Diplomatik (Urkundenlehre) ist
daher ein unerlässliches Instrument zur Entschlüsselung und Interpretation
herrscherlicher Politik. Mit ihrer Hilfe lassen sich nicht zuletzt auch
gefälschte Urkunden aufspüren. In der Übung sollen daher Grundfertigkeiten in der Arbeit mit spätmittelalterlichen
Urkunden, wie etwa das Lesen der mittelalterlichen Schriften oder das
Interpretieren der äußeren und inneren Merkmale und Formalia vermittelt werden,
wobei ein Schwerpunkt auf das frühe 15. Jahrhundert gelegt wird.
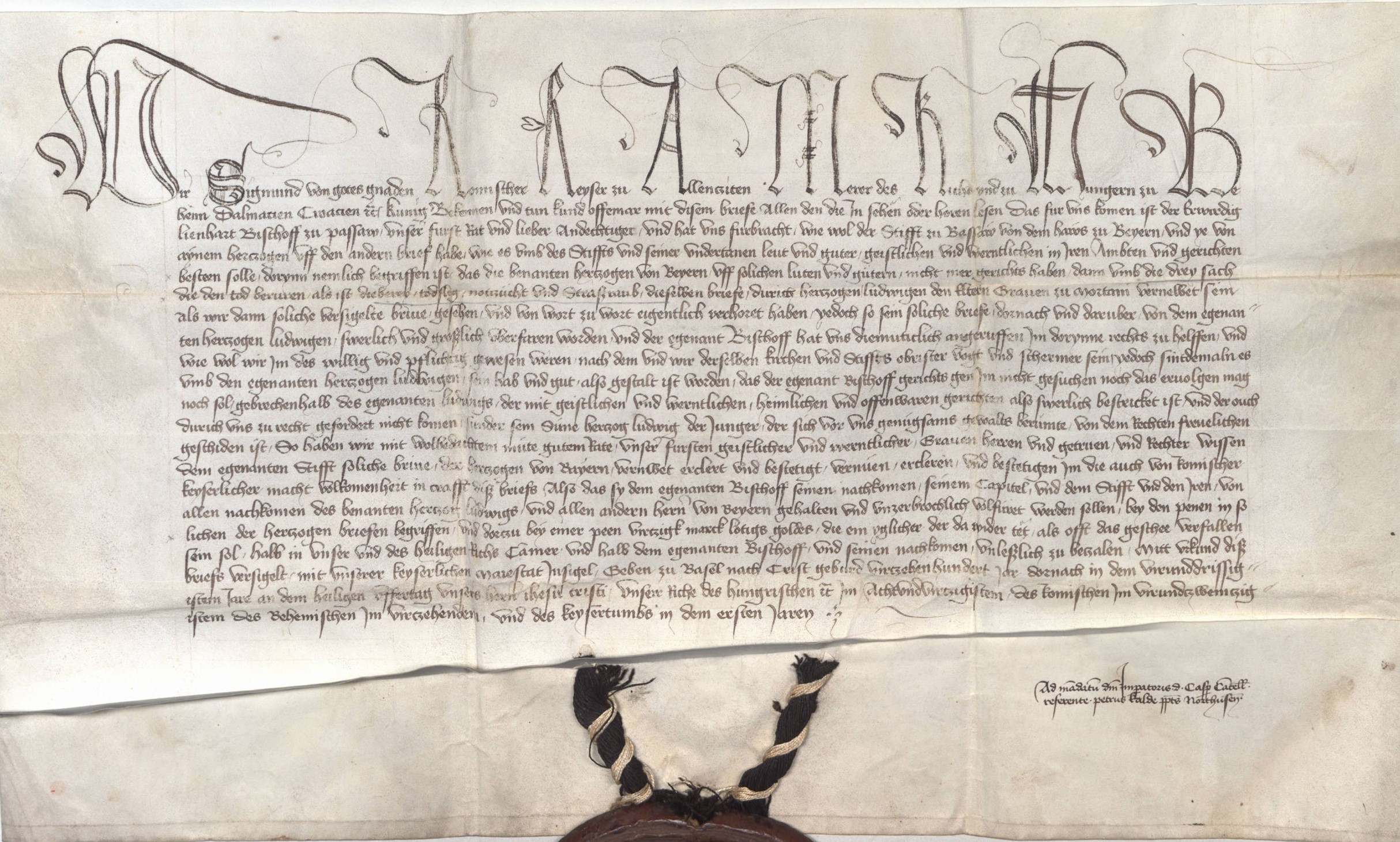
- Trainer/in: Philipp Laumer
Auf der Handschriftenkunde ruhen Editionen, sie liefert der Wissenschaft neue Quellen und und Erkenntnisse. Doch die wissenschaftliche Beschreibung einer Handschrift stellt mancherlei Anforderungen an den Bearbeiter, denn in kaum einem Bereich der historischen Grundlagenforschung fließen so viele Teildisziplinen zusammen wie dort. Dazu gehören neben Kenntnissen in Paläographie, Kodikologie und Einbandkunde vor allem auch fundierte sprachliche Kenntnisse, um die (mehrheitlich lateinischen) Texte entziffern, verstehen und identifizieren zu können. Die Übung möchte eine praxisorientierte Einführung in die verschiedenen Schritte und Aspekte der Handschriftenerschließung geben, Grundlagen der Paläographie und Kodikologie vermitteln und dabei vor allem Gelegenheit zu eigenem Lesen, Transkribieren und Nachforschen bieten. Für die Teilnahme sind Grundkenntnisse des Lateinischen empfehlenswert.
- Trainer/in: Sabine Buttinger
Im Rahmen des Historikertags 2021 in München sollen
in Form einer Vitrinenausstellung die bekanntesten Stücke (insbesondere
Handschriften, aber auch Karten) aus der Sammlung der Münchener
Universitätsbibliothek präsentiert werden. Die Lehrveranstaltung dient der
Gestaltung dieser Ausstellung: Ziel ist, zunächst die Bedeutung und die
Wirkungsgeschichte der betreffenden Objekte zu erschließen, ehe in einem
zweiten Schritt überlegt werden soll, wie das jeweilige Exponat in der
Ausstellung am wirkungsvollsten präsentiert und mit welchen Begleittexten es
einer breiteren Öffentlichkeit erschlossen werden kann.
- Trainer/in: Martin Wagendorfer
Die lateinische Sprache, in der die meisten
mittelalterlichen und auch viele neuzeitliche Quellen abgefasst sind, stellt
erfahrungsgemäß eine gewisse Hemmschwelle bzw. Eingangshürde bei der
Beschäftigung mit diesen Quellen dar, zumal typisch mittelalterliche Quellen
wie Urkunden oder hagiographische Texte auch eine eigene Herangehensweise
verlangen. Die Lehrveranstaltung hat das Ziel, diese Hemmschwelle abzubauen und
in den adäquaten Umgang mit diesen Quellen einzuführen. Zunächst soll ein
kurzer Überblick über die Geschichte der Disziplin Mittel- und Neulatein
gegeben werden, anschließend werden die wichtigsten Hilfsmittel für die
Übersetzung lateinischer Quellen sowie ihre richtige Benützung vorgestellt. Im
Hauptteil der Veranstaltung sollen dann gemeinsam exemplarische Texte gelesen
werden, an denen die Eigenheiten des mittelalterlichen und neuzeitlichen Latein
sowie bestimmter Quellengattungen aufgezeigt werden sollen.
- Trainer/in: Martin Wagendorfer
Im Oberseminar wird über den Stand der laufenden
Bachelorarbeiten, Master-/Magister-arbeiten und Dissertationen berichtet; zudem
stellen Mitarbeiter und auswärtige Kollegen ihre Projekte vor.
- Trainer/in: Martin Wagendorfer
Im Lektürekurs innerhalb des Master-Studiengangs
lesen die Studierenden selbständig wissenschaftliche Literatur, die zu den
Grundlagenwerken des Faches gehört oder einen besonderen Einfluss auf die
Forschung ausgeübt hat. Die Auswahl der Titel erfolgt in Absprache mit dem
Dozenten in der ersten Sitzung; in einer Zwischenbesprechung gegen Mitte des Semesters
können etwaig auftretende Fragen oder Probleme erörtert werden; in der
mündlichen Abschlussbesprechung am Semesterende wird die Lektüre diskutiert.
- Trainer/in: Martin Wagendorfer
- Trainer/in: Martin Wagendorfer
Wissentlich verbreitete Falschmeldungen dienen der
politischen Propaganda, sind gezielte Strategie der Desinformation und
beeinflussen politische Entscheidungen. Nicht nur die Gegenwart, auch das Mittelalter
bietet zahllose Beispiele für den manipulativen Umgang des Menschen mit dem
Wahrheitsbegriff. Wie lässt sich mit Hilfe der grundwissenschaftlichen
Disziplinen der Diplomatik, Paläografie, Sphragistik und Chronologie die
Authentizität historischer Quellen überprüfen? Was war die Motivation der
mittelalterlichen Fälscher? Und was passierte mit Fälschern, sofern deren Tun
überhaupt zeitnah entdeckt wurde? Die Übung bietet unter anderem die
Möglichkeit, anhand der Erkenntnisse der großen Regesten-Werke (Regesta
Imperii) und kritischen Urkunden-Editionen (MGH) Fälschungsmerkmale an vorgeblichen
Kaiser- und Königsurkunden nachzuvollziehen. Die Ritualmordlegende, die immer
wieder Vorwand für die Unterdrückung und Verfolgung von Juden war, bietet ein
Beispiel für die politische Propaganda verantwortlicher Stadt- bzw.
Landesherren, die durch Textquellen entlarvt werden kann.

- Trainer/in: Susanne Wolf
- Trainer/in: Stefan Petersen
Die noch junge Wissenschaft der mittelalterlichen
und neuzeitlichen Epigraphik hat innerhalb der letzten 25 bis 30 Jahre eine
rasante Entwicklung erfahren, die sich im eifrigen Ausbau der europaweiten
Editionen der Quelle Inschrift in nationalen Inschriftencorpora sowie in zahlreichen
schrift- und formularkundlichen Untersuchungen niederschlug. Trotz vielfältiger
in- und ausländischer Aktivitäten bleibt die Erstellung einer
gesamteuropäischen Epigraphik für viele Inschriftenarten weiterhin ein
Desiderat der Forschung. Die Vorstellung eines einheitlichen
Entwicklungsverlaufes von Schrift und Formular, wie er über weite Strecken im
deutschen Sprachraum nachzuvollziehen ist, muss aus gesamteuropäischer Sicht
nicht selten modifiziert und korrigiert werden. Die an epigraphisch
Fortgeschrittene gerichtete Veranstaltung beschäftigt sich mit den
„Brennpunkten“ der epigraphischen Forschung und den Möglichkeiten und Grenzen
der regionalen und zeitlichen Einordnung von Inschriftendenkmälern anhand epigraphischer
Methoden.
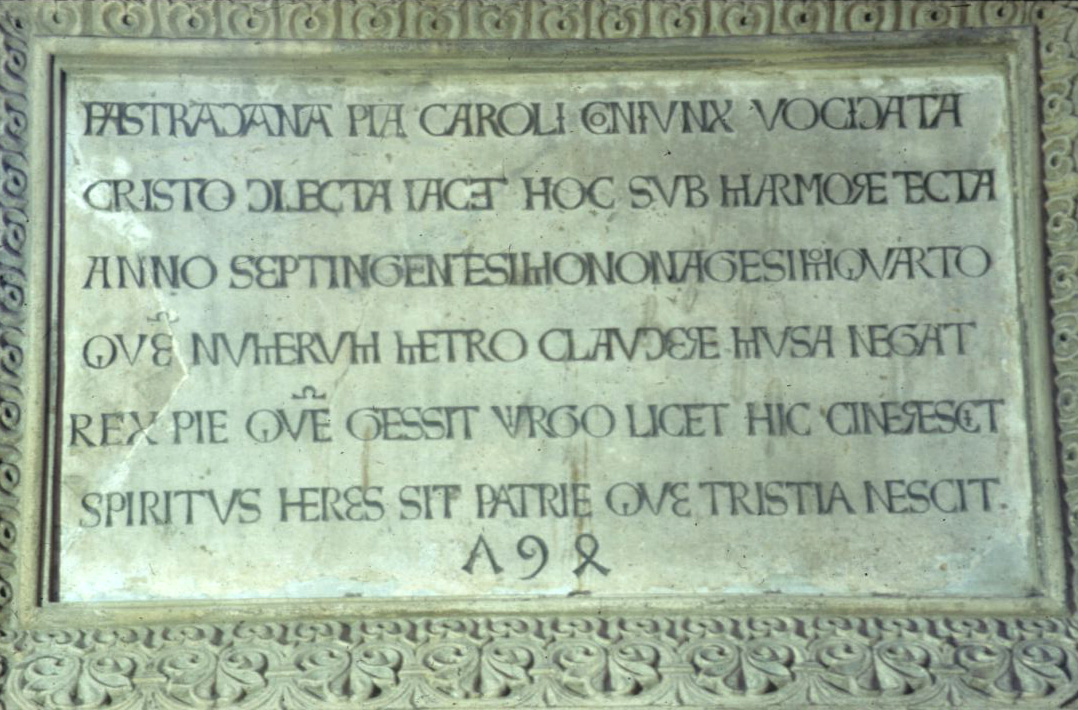
- Trainer/in: Franz Bornschlegel
Die Veranstaltung vermittelt einen Überblick über
die gebräuchlichen Schriftformen der Inschriften von der römischen Antike bis
in die frühe Neuzeit, wobei auch wichtige regionale wie materialspezifische
Sonderentwicklungen der Schrift berücksichtigt werden. Den Schwerpunkt bildet
Zentraleuropa, insbesondere der deutsche Sprachraum. Eine bedeutende Rolle
spielen zu gewissen Zeiten auch randeuropäische Schriftphänomene, die wir
ebenfalls in den Blick nehmen wollen. Im Rahmen von Referaten sollen Sie ausgewählte
Inschriften vorstellen, die formalen Merkmale beschreiben und die Schrift
entwicklungsgeschichtlich einbetten.
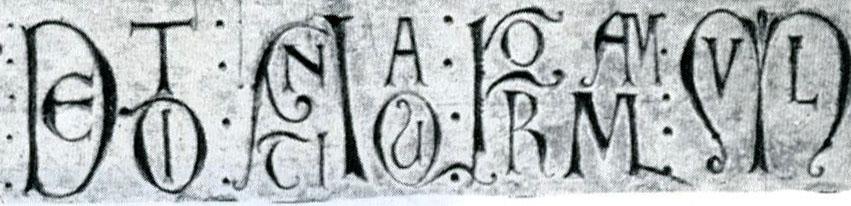
- Trainer/in: Franz Bornschlegel
Die Veranstaltung dient zur Einführung in die Grundbegriffe, Arbeitsmethoden und Hilfsmittel der Historischen Grundwissenschaften, die sich aus etwa einem Dutzend unterschiedlicher, etablierter wie junger Forschungszweige zusammensetzen. Jedes Fach ist für sich autonom und erfordert eigene Fragestellungen und Methoden. Zu den klassischen Gebieten der Geschichtlichen Hilfswissenschaften zählen die Diplomatik (Urkundenlehre) und die Paläographie (Lehre der Entwicklung der lateinischen Schrift), die den Schwerpunkt der Veranstaltungen bilden. Ferner gilt die Betrachtung den eng in Zusammenhang mit diesen Kernfächern stehenden Forschungsbereichen Chronologie (Zeitrechnungslehre) und Sphragistik (Siegelkunde) sowie der an der hiesigen Abteilung besonders gepflegten, jungen Disziplin der Epigraphik (Inschriftenkunde) des Mittelalters und der Neuzeit.
Grundkenntnisse in Latein von Vorteil!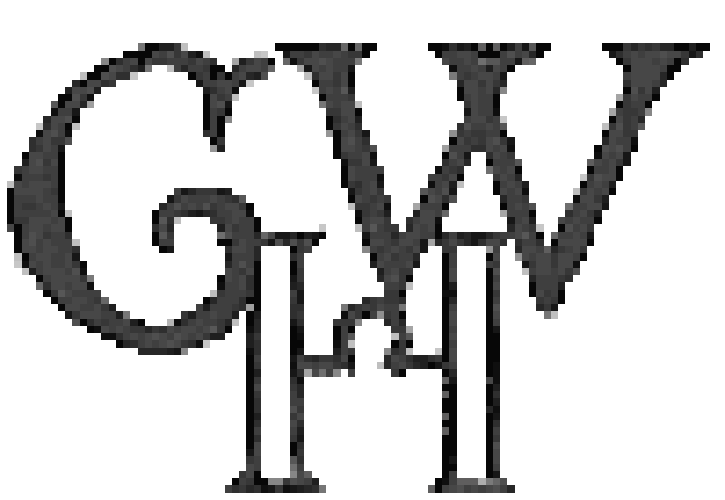
- Trainer/in: Franz Bornschlegel