Medien sind für viele Menschen eine wichtige Quelle, wenn sie sich über Gesundheit und Krankheit informieren. Auch in sozialen Medien begegnen uns alltäglich gesundheitsbezogene Inhalts, häufig auch ganz beiläufig. Die mediale Darstellung von Gesundheitsthemen kann beeinflussen, wie Menschen über Gesundheit denken oder wie sie sich selbst verhalten. Doch wie werden gesundheitsbezogene Inhalte eigentlich in den Medien dargestellt?
Im Rahmen eines empirischen Forschungsprojekts werden Sie in diesem Seminar in Kleingruppen eigene Projekte zu selbst gewählten Gesundheitsthemen entwickeln und durchführen, um die Methode der Medieninhaltsanalyse zu erlernen. Dabei werden alle Schritte des empirischen Forschungsprozesses vom Aufstellen von Forschungsfragen bis zur Datenanalyse durchlaufen.
- Teacher: Mara Berlekamp
Mit dem Auftreten generativer KI in der breiten Öffentlichkeit ging ein erhebliches Maß an medialer Aufmerksamkeit einher. In hoher Taktfolge wird teils von gewaltigen Chancen geschwärmt oder auch vor enormen Risiken gewarnt. In diesem Seminar werden die Berichterstattung und Darstellungen von generativer KI in den Medien (z.B. in der Presse, Unternehmens-PR, auf sozialen Medien) untersucht. Zu behandelnde Fragen können sein: Wie berichten verschiedene Medien über generative KI, stehen eher Chancen oder Risiken im Vordergrund, sind positive oder negative Emotionen mit der Berichterstattung verknüpft, wie präsentieren Firmen ihre KI-Technologie?
Aufbauend auf theoretischen Überlegungen zu Narrativen, Imaginaries und Framing sowie dem Kennenlernen von existierender Forschung zur Thematik liegt der Schwerpunkt des Seminars auf dem Erlernen und der Durchführung einer quantitativen bzw. automatisierten Inhaltsanalyse zur Thematik. Der Fokus des Seminars liegt auf der Analyse einer kleinen Menge eigenständig gesammelter Texte; auf Wunsch können auch visuelle Elemente untersucht werden. Es wird im Seminar mit R und ggf. Python gearbeitet, es sind allerdings keinerlei Vorkenntnisse nötig. Alle notwendigen Schritte werden Ihnen im Seminar beigebracht und Sie werden bei der Durchführung der Inhaltsanalyse begleitet. Ein abschließendes Ziel ist die Bewertung der durchgeführten Analysen sowie die gemeinsame Diskussion und Reflexion der Befunde zum Thema.
- Teacher: Michael Reiß
Was erforschen eigentlich Kommunikationswissenschaftler:innen? Welche Medieninhalte und Medienwirkungen werden mit welchen Methoden untersucht? Welche Rolle spielen dabei inzwischen Social Media, Apps, Netflix etc.?
Fachzeitschriften sind besonders gut dazu geeignet, einen Überblick über die Entwicklung einer Disziplin zu erhalten. Wir werden uns im Semester mit den Inhalten und Autor:innen von deutschsprachigen Fachzeitschriften auseinandersetzen.
Wir untersuchen mit einer quantitativen Inhaltsanalyse die Beiträge in Fachzeitschriften. Sie lernen dabei aktuelle Theorien und Untersuchungsgegenstände und -anlagen kennen und bekommen einen Überblick über „erfolgreiche“ Standorte im deutschsprachigen Raum.
- Teacher: Alexander Haas
This seminar offers a critical exploration of alternative media as a complex and multifaceted phenomenon. Moving beyond the dominant focus on far-right populist outlets, students will engage with the historical roots, political functions, and diverse forms of alternative media. Through small, student-led qualitative projects, participants will formulate their own research questions and learn to conduct thematic analyses of selected media content. The course provides both theoretical grounding and hands-on methodological training suitable for students in media, communication, and political or social studies.
The course is organized into five thematic blocks:
- Foundations: What are alternative media? What fields do they operate in, and how do they relate to other (media) actors?
- Conceptual depth: How can we understand alternative media as critical media, and why are far-right actors currently so prominent in this space?
- Relations and tensions: How do alternative and mainstream media interact, compete, or coexist?
- Epistemic perspectives: How do alternative media contribute to counter-knowledge and alternative epistemologies, and what implications does this have for informed citizenship and democracy?
- Methodological application: Introduction to thematic analysis and its use in studying alternative media.
Throughout the semester, we will continuously work on your individual or group research projects. Several sessions will be dedicated entirely to hands-on research and peer feedback.
Goals and expectations at a glance:
• Understand the historical origins, motivations, and functions of alternative media
• Develop and refine your own research question on alternative media
• Collect and conduct a thematic analysis of alternative media content
• Present your findings in a well-structured and compelling research paper
- Teacher: Florian Primig
Wie geht die aktuelle Berichterstattung mit dem Thema Klima(-wandel) auf Social Media um? Dieser (großen) Frage wollen wir uns in diesem Methodenseminar annähern.
Hierfür haben wir einen umfassenden Datensatz, der eine Vollerhebung aller Facebook- und Instagram-Posts von 20+ verschiedenster Medien-Outlets (von taz bis Tichys Einblick) aus dem deutschsprachigen Raum seit 2014 darstellt und der als Basis Ihrer Forschungsarbeit dienen (kann). Zuerst werden Sie im Rahmen methodischer und teils inhaltlicher Referate verschiedene Arten der Inhaltsanalyse – qualitativ wie auch quantitative – kennenlernen und erörtern. Im nächsten Schritt werden Sie in Guppen Ihr Wissen praktisch in einem Forschungsprojekt anwenden und in einem Forschungsbericht vorstellen. Aufgrund des großen Datensatzes haben Sie die Möglichkeit eine Forschungsarbeit nach Ihren Interessen durchzuführen.
Die Arbeitsweise im Seminar ist einerseits auf das gemeinsame Diskutieren und Erarbeiten von Inhalten ausgelegt (z.B. hinsichtlich Literatur und des Übens von Analysestrategien). Andererseits ist die Arbeit in Kleingruppen geplant (insbesondere bei der Konzeption, Planung und Umsetzung).
Ziel des Seminars ist neben des Erlernens der Konzeption, Planung und Durchführung verschiedener Arten der Inhaltsanalyse die gemeinsame Diskussion und Reflexion der Befunde und wie man diese in den gesellschaftlichen Gesamtdiskurs einordnen kann. Zu den Leistungsanforderungen gehören ein Referat und eine Forschungsarbeit (Einzel-/Gruppenarbeit). Bitte bringen Sie zur ersten Sitzung einen Laptop mit installierter Zotero-Software und vor allem Neugier und Interesse mit.

- Teacher: Laura Aleman
- Teacher: Maximilian Lechner
Bisherige Forschung hat sich umfangreich mit Wissenschaftsjournalist*innen als zentrale Gatekeeper*innen der Wissenschaftskommunikation beschäftigt; diese wählen wissenschaftliche Themen unter anderem nach spezifischen Nachrichtenwerten und -faktoren aus (Galtung & Ruge, 1965; Shoemaker & Reese, 2014). Frühere Befunde deuten beispielsweise darauf hin, dass sich die Nachrichtenwerte und -faktoren im Wissenschaftsjournalismus von denen anderer Berichterstattungsfelder teilweise unterscheiden: Neben klassischen Nachrichtenfaktoren wie Personalisation, Kontroversität oder auch geographische Nähe, sind im wissenschaftlichen Kontext unter anderem Aspekte wie Neuigkeit, Erstaunen („astonishment“) oder gesellschaftliche Relevanz von besonderem Interesse. Durch zahlreiche Herausforderungen – etwa durch Medialisierung, Globalisierung und Digitalisierung – können Journalist*innen ihrer Gatekeeping-Funktion jedoch nicht mehr allein gerecht werden. Vermehrt nehmen auch Wissenschaftler*innen, wissenschaftliche Institutionen sowie deren PR-Abteilungen Einfluss auf die öffentliche Wissenschaftskommunikation – und orientieren sich dabei womöglich an anderen Nachrichtenwerten und -faktoren.
Das Seminar behandelt deshalb Nachrichtenwerte und -faktoren in der Wissenschaftskommunikation – insbesondere in Pressemitteilungen wissenschaftlicher Institutionen beim Informationsdienst Wissenschaft (idw) sowie ggf. in anknüpfender journalistischer Berichterstattung. Im Verlauf des Seminars wird dabei eine Einführung in die Medieninhaltsforschung mit Fokus auf die Methode der Inhaltsanalyse gegeben. Die Teilnehmer*innen lernen, wie wissenschaftliche Inhalte in Pressemitteilungen und den Medien analysiert und interpretiert werden können. Ziel ist es, ein kritisches Verständnis für die Darstellung wissenschaftlicher Themen zu entwickeln und methodische Kompetenzen in der Inhaltsanalyse zu erwerben.
- Teacher: Janise Brück
How
is sentiment in economic reporting conveyed through media? What topics
does finstagram (finances on instagram) or fintok (finances on tiktok)
discuss? What role do these discussions play in the context of stock
market fluctuations? How could it happen that reddit made the gamestop
stock soar? And how can artificial intelligence help us analyze and
understand these complex narratives? |
- Teacher: Patrick Parschan
- Teacher: Lukas Friedrich
Die Trennung zwischen Wissenschaft und Politik ist oftmals unscharf: auf
der einen Seite haben viele wissenschaftliche Themen ein politisches Ausmaß und
direkte Auswirkungen auf politische Entscheidungen, auf der anderen Seite
werden wissenschaftliche Erkenntnisse (bspw. durch politische Akteur*innen)
genutzt, um politische Agenden zu verfolgen. Das kann nicht nur die
Objektivität und Glaubwürdigkeit der Wissenschaft untergraben, sondern auch die
gesellschaftliche Akzeptanz und Umsetzung wissenschaftlicher Empfehlungen
beeinflussen, was sich z. B. beim Klimawandel, KI und COVID-19 zeigt. Auch
Medien tragen erheblich zu einer Politisierung von Wissenschaft bei, indem sie
die Wahrnehmung und Interpretation wissenschaftlicher Erkenntnisse formen und
mit politischer Berichterstattung verknüpfen. Das Seminar widmet sich deshalb
der Politisierung von Wissenschaft in der Medienberichterstattung. Im Verlauf
des Seminars wird dabei eine Einführung in die Medieninhaltsforschung mit Fokus
auf die Methode der Inhaltsanalyse gegeben. Die Teilnehmer*innen lernen, wie
wissenschaftliche Inhalte in den Medien analysiert und interpretiert werden
können. Ziel ist es, ein kritisches Verständnis für die Darstellung
wissenschaftlicher Themen in den Medien zu entwickeln und methodische
Kompetenzen in der Inhaltsanalyse zu erwerben.

- Teacher: Janise Brück
- Teacher: Justin Schröder
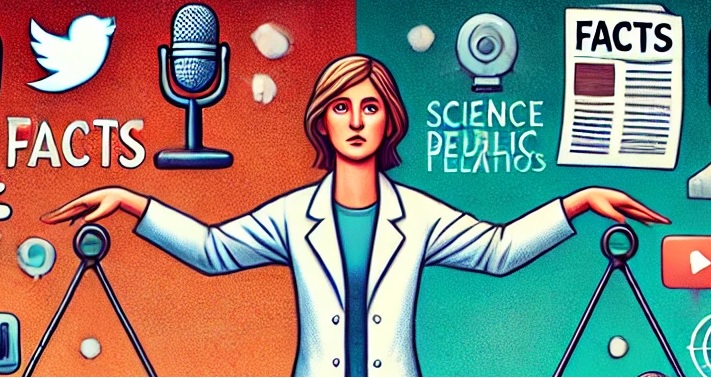
- Teacher: Lars Guenther
- Teacher: Justin Schröder
- Teacher: Sophia Rothut
„Cancel Culture“, „Political Correctness“, „Meinungsdiktatur“ - das Thema Meinungsfreiheit wird in der öffentlichen Debatte seit ein paar Jahren zunehmend und polarisiert diskutiert. Doch wie wird in der Medienberichterstattung und auf Social Media über eines der grundlegendsten demokratischen Grundrechte geschrieben? Und wie werden dabei Rechte angesprochen, die der Meinungsfreiheit gegenüberstehen können, wie die Toleranz und Freiheit vor Diskriminierung? Gemeinsam wollen wir uns im Seminar diesen Fragen widmen. Dafür lernen Sie die Methode der Medieninhaltsforschung kennen und werden sie am Thema der Meinungsfreiheit anwenden. |
- Teacher: Anna-Luisa Sacher