- Trainer/in: Fabian Jonietz
- Trainer/in: Stefanie Schneider
Die Vorlesung wird eine monografischen Übersicht zu Künstlerinnen in der
Frühen Neuzeit geben. In den letzten vierzig Jahren ist die Literatur
dazu sprunghaft angewachsen. Es ist Zeit einen Überblick zu geben. Die
Vorlesung behandelt Fragen der Künstlersozialgeschichte und der
Geschlechterforschung. Am Beispiel der weiblichen Künstler gibt sie
einen Einblick in das Feld der Künstler und der Kunst in der Frühen
Neuzeit.

- Trainer/in: Matteo Burioni
Das Seminar geht dem Grund auf den Grund. Malerei fand während der
Frühen Neuzeit längst nicht nur auf Leinwand und Holztafel statt,
sondern auf einer Vielfalt von Bildträgern. Als Malgründe dienten, auch
für Protagonist:innen der Epoche, unter anderem: Tafeln aus Kupfer,
Halbedelsteinen oder Elfenbein, Glasscheiben (Hinterglasmalerei),
Geschirr (Majolika, Porzellanmalerei), Stoffe (‚Tüchlein‘-Malerei,
Malerei auf Seide, z.B. bei Guido Reni), kleine Elfenbeinplättchen
(Porträtminiaturen, z.B. von Rosalba Carriera) - ja, sogar Spinnenweben.
Auch die „shaped canvas“ kannte Vorläufer, so nahmen etwa Holztafeln die
Form von Schilden (Caravaggios ‚Medusa‘), Staffeleien (Gijsbrecht) oder
Paravents (neuspanische ‚Biombos‘) an. Zu diskutieren wäre zudem, ob
auch das Schminken oder das farbige Fassen von Skulpturen sowie von
"Gebrauchs-"Gegenständen wie Möbeln oder Geschirr Grenzbereiche der
Malerei sind.
Solche Objekte werfen die Grundsatzfrage auf, was Malerei überhaupt ist:
Inwiefern bestimmen Material und Form(at) des Bildträgers die Aussage
des Bildes mit? Wie interagieren Material und (illusionistische) Malerei
miteinander? Wann ist etwas überhaupt noch Malerei und wann bloß
Bemalung - wann ein Bild ein Bild, wann ein Objekt?
- Trainer/in: Ulrike Keuper

- Trainer/in: Dorothee Binder
- Trainer/in: Boris Cuckovic
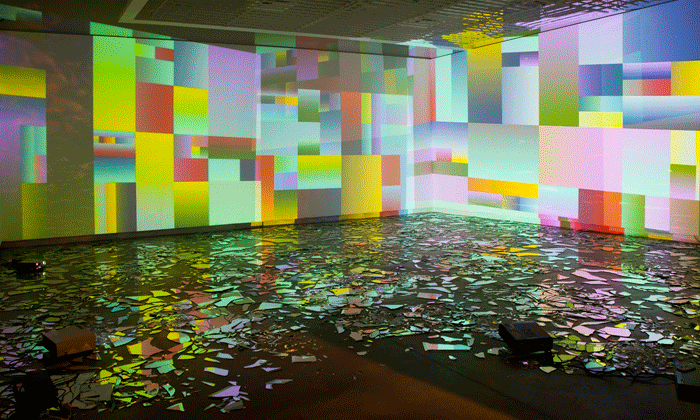
- Trainer/in: Dorothee Binder
- Trainer/in: Boris Cuckovic
Kaum ein deutscher Künstler dürfte von seinem Namen her so bekannt sein wie der Nürnberger Albrecht Dürer. Und in der Tat kommt sein Ruhm nicht von ungefähr: Für viele künstlerische Techniken und Darstellungsformen war er Wegbereiter für künftige Generationen, sei es in der Druckgraphik oder der Malerei, mit der er die neuesten Errungenschaften der italienischen Renaissance im nordalpinen Raum bekannt machte. Er verfasste kunsttheoretische Traktate, verkehrte in Gelehrtenkreisen und arbeitete für die höchsten Staatsmänner. Mit wachem Auge dokumentierte er in zahlreichen Bildzeugnissen seine Reisen, Details aus der Natur, aber auch seinen Gesundheitszustand und nicht zuletzt in mehreren Selbstbildnissen die eigene Person.
Im Seminar wollen wir uns seinem Leben und Werk widmen, ihn auf seinen Reisen begleiten und seine Texte lesen, wobei wir zugleich reflektieren, wie man sich einem künstlerischen Oeuvre und Werken der bildenden Kunst unter heutigen methodischen Bedingungen nähern kann. Die Veranstaltung führt zudem grundlegend ein in kunsthistorische Arbeitsweisen (Bildbeschreibung, Deutung von Bildinhalten, Arbeit mit historischen Quellen) und richtet sich daher vor allem an Studienanfänger.

- Trainer/in: Gabriele Wimböck
- Trainer/in: Dorothee Binder
- Trainer/in: Stefanie Schneider
Im Rahmen des Vertiefungskurses werden wir uns ergänzend zur Einführungsvorlesung mit den künstlerischen Entwicklungen ab dem 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart beschäftigten. Im Fokus steht hierbei die Schärfung kunsthistorischer Methodiken ebenso wie die überblickshafte Einführung in verschiedene Stilrichtungen.
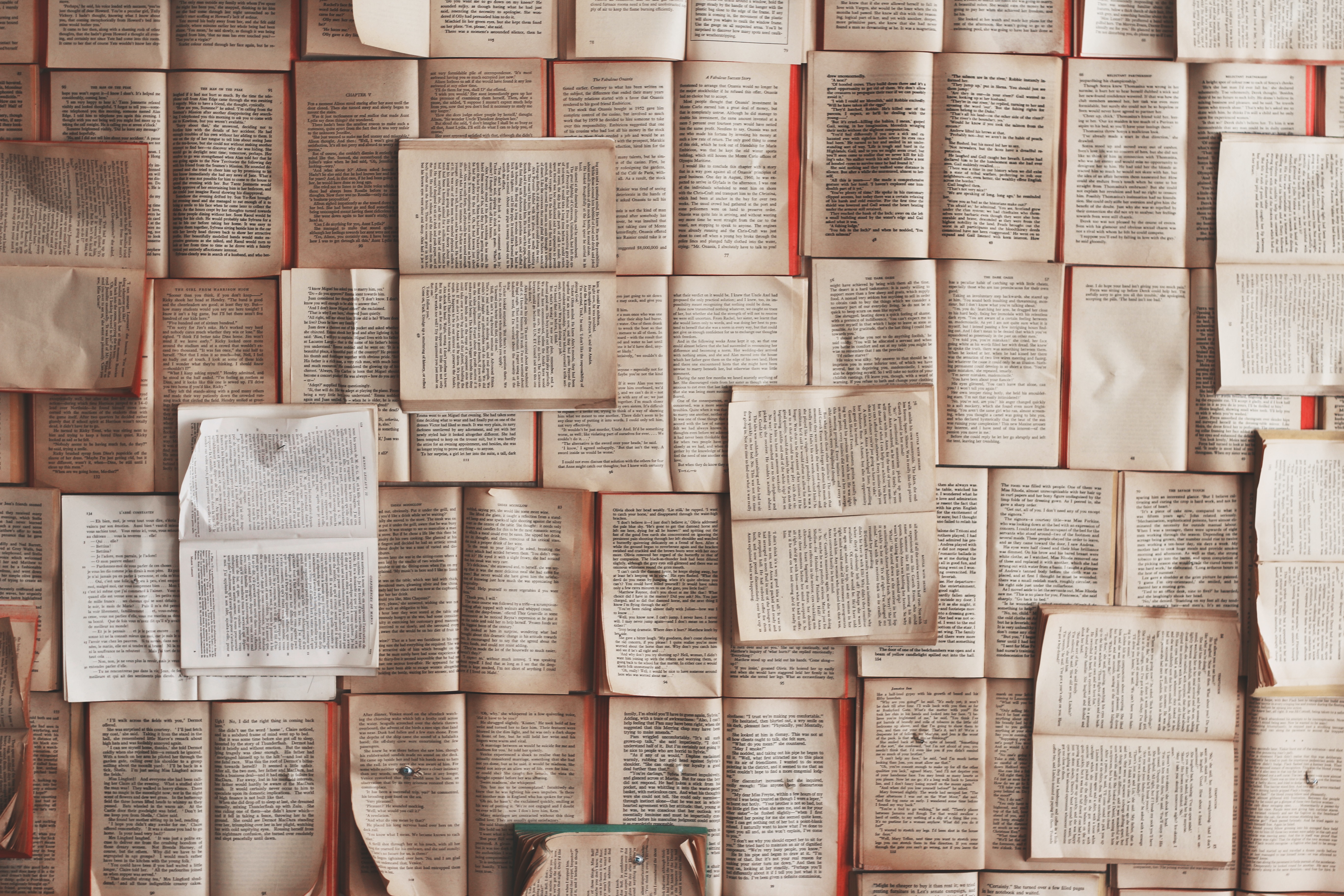
- Trainer/in: Buket Altinoba
- Trainer/in: Dorothee Binder
- Trainer/in: Ulrike Keuper
- Trainer/in: Elisa Ludwig
Im Dezember 2019 sah sich das Getty Museum (Los Angeles, USA) mit den Vorwürfen einer Falschzuschreibung konfrontiert: Forscher:innen konnten nachweisen, dass die bis dato Gaugin zugeschriebene Skulptur „Head with Horns“ nicht von diesem stammt. Hierbei zeigten sie auf, wie durch die Rezeption bisheriger Veröffentlichungen und dem fehlenden Überprüfen ursprünglicher Quellen die falsche Zuschreibung zu dem Künstler immer mehr verfestigt wurde. Dieses Fallbeispiel wollen wir als Ausgangspunkt nutzen, um unseren Blick für eine wichtige Quellengattung bei der Erforschung von Provenienzen zu schärfen und uns gemeinsam auf detektivische Spurensuche zu begeben, um gängige Narrative mit einem Blick auf die Quellen kritisch zu hinterfragen.
Karteikarten und digitale Datenbanken bilden für Kunsthistoriker:innen eine zentrale Quelle für die Analyse eines Kunstobjektes. Schwerpunktartig, aber nicht ausschließlich, wollen wir vor dem Hintergrund der Provenance Studies Karteikarten auf ihre Bedeutung für die Provenienzforschung untersuchen.
Zu Beginn werden wir uns den Dokumentationsprozess eines (Museums-)Objektes anhand des Leitfadens Dokumentation von Museumsobjekten erarbeiten. Diesen werden wir in die Entwicklungsschritte von analogen hin zu digitalen Dokumentationssystemen vor dem Hintergrund der Zugänglichkeit kontextualisieren. Hiervon ausgehend werden wir anhand einzelner Fallbeispiele untersuchen, welche Informationen und Datensätze durch die Dokumentation gewonnen werden können, wie diese erfasst werden müssen und wie diese kritisch zu interpretieren sind. Durch Exkursionen in verschiedene Münchner Einrichtungen wie das Lenbachhaus oder das Universitätsarchiv erhalten Sie Einblicke in das tägliche Arbeiten mit diesem Quellenkorpus. Ziel ist es, Ihnen hierbei beizubringen, wie Sie diese Quelle für die Provenienzforschung nutzen können. Hierbei wollen wir uns gemeinsam einem reflektierten Umgang mit historischen Quellen, aber auch digitalen Datenbanken, annähern.

- Trainer/in: Dorothee Binder
- Trainer/in: Elisa Ludwig
- Trainer/in: Mandana Bender
- Trainer/in: Dorothee Binder
- Trainer/in: Margaret Shortle
- Trainer/in: Mandana Bender
- Trainer/in: Dorothee Binder
- Trainer/in: Margaret Shortle
- Trainer/in: Dorothee Binder
- Trainer/in: Sophie Junge
- Trainer/in: Dorothee Binder
- Trainer/in: Sophie Junge
- Trainer/in: Dina Kagan
- Trainer/in: Stefanie Schneider
- Trainer/in: Dorothee Binder
- Trainer/in: Sophie Junge