Im Seminar sollen in Arbeitsgruppen Forschungsprojekte zum Framing kontroverser Themen in den Medien durchgeführt werden. Methode wird dabei die qualitative Inhaltsanalyse sein. Die Relevanz dieser Fallstudien kann unter anderem mit den journalismuskritischen Positionen begründet werden, die seit einigen Jahren immer wieder Teil der öffentlichen Kommunikation sind. Interessant ist hier insbesondere der Vorwurf der gleichförmigen Berichterstattung. Welche Themenbereiche konkret bearbeitet werden, richtet sich nach den Interessen der Teilnehmenden und wird im Seminar bestimmt. Grundlage ist eine öffentlichkeitstheoretische Einführung.
- Docente: Manuel Wendelin
Verschiedene soziale Gruppen werden in unserer Gesellschaft stigmatisiert und diskriminiert—beispielsweise aufgrund ihrer Obdachlosigkeit, ihres Migrations-hintergrunds oder ihrer sexuellen Orientierung. Die Forschung hat gezeigt, dass Narrationen zur Entstigmatisierung beitragen können, da sie es ermöglichen, die Perspektive einer stigmatisierten Person einzunehmen.
Doch wie genau sollen narrative Mediendarstellungen gestaltet werden, um diese positiven Effekte zu erzielen? In diesem Kurs werden wir zunächst die theoretischen Grundlagen zu (Ent-)Stigmatisierung und narrativer Persuasion aufarbeiten, um darauf aufbauend relevante Forschungsfrage(n) zur Wahrnehmung, Rezeption oder Wirkung von positiven Darstellungen stigmatisierter Personen in Narrationen zu formulieren und diese mit der jeweils geeignetsten Methode qualitativ oder quantitativ zu untersuchen.- Docente: Freya Sukalla
Diese Vorlesung ist als Ringvorlesung angelegt, in der Lehrende des IfKW reihum einen Einblick in ihre jeweiligen Fachgebiete und damit in alle wesentlichen Forschungsfelder der Kommunikationswissenschaft geben. Im Mittelpunkt stehen dabei aktuelle Entwicklungen im Fach und in der Gesellschaft, die das jeweilige Teilgebiet unserer Disziplin berühren. So bietet die Veranstaltung die Möglichkeit, den aktuellsten Stand der Forschung zu einer großen Bandbreite an Fragestellungen kennenzulernen und zu reflektieren.

- Docente: Diana Rieger
Wie lassen sich aktuelle gesellschaftliche Debatten wie Desinformation, Klimawandel oder KI-Entwicklung aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive einordnen? Und was verraten uns zentrale Theorien über den Wandel von Öffentlichkeit, Mediennutzung oder Journalismus? Im Seminar P 1.1 nähern wir uns diesen Fragen über einen breit angelegten Lektürekurs: Jede Woche steht ein wissenschaftlicher Beitrag im Zentrum - mal eine klassische Theoriearbeit, mal eine aktuelle empirische Studie. Gemeinsam rekonstruieren wir Argumentationslinien, diskutieren theoretische Grundlagen und methodische Zugänge und überlegen, welche Implikationen die jeweiligen Studienergebnisse für das Feld und die Gesellschaft haben können. Dabei setzen wir uns sowohl mit etablierten Bereichen wie politischer Kommunikation, Nutzungs- oder Wirkungsforschung auseinander als auch mit neueren Perspektiven aus Gesundheits- oder Klimakommunikation, kritischen Ansätzen (z. B. Feminismustheorie) oder Computational Methods. Ziel ist es, zentrale theoretische und methodische Zugänge der Kommunikationswissenschaft kennenzulernen sowie sie aktiv zu diskutieren, kritisch einzuordnen und weiterzudenken.
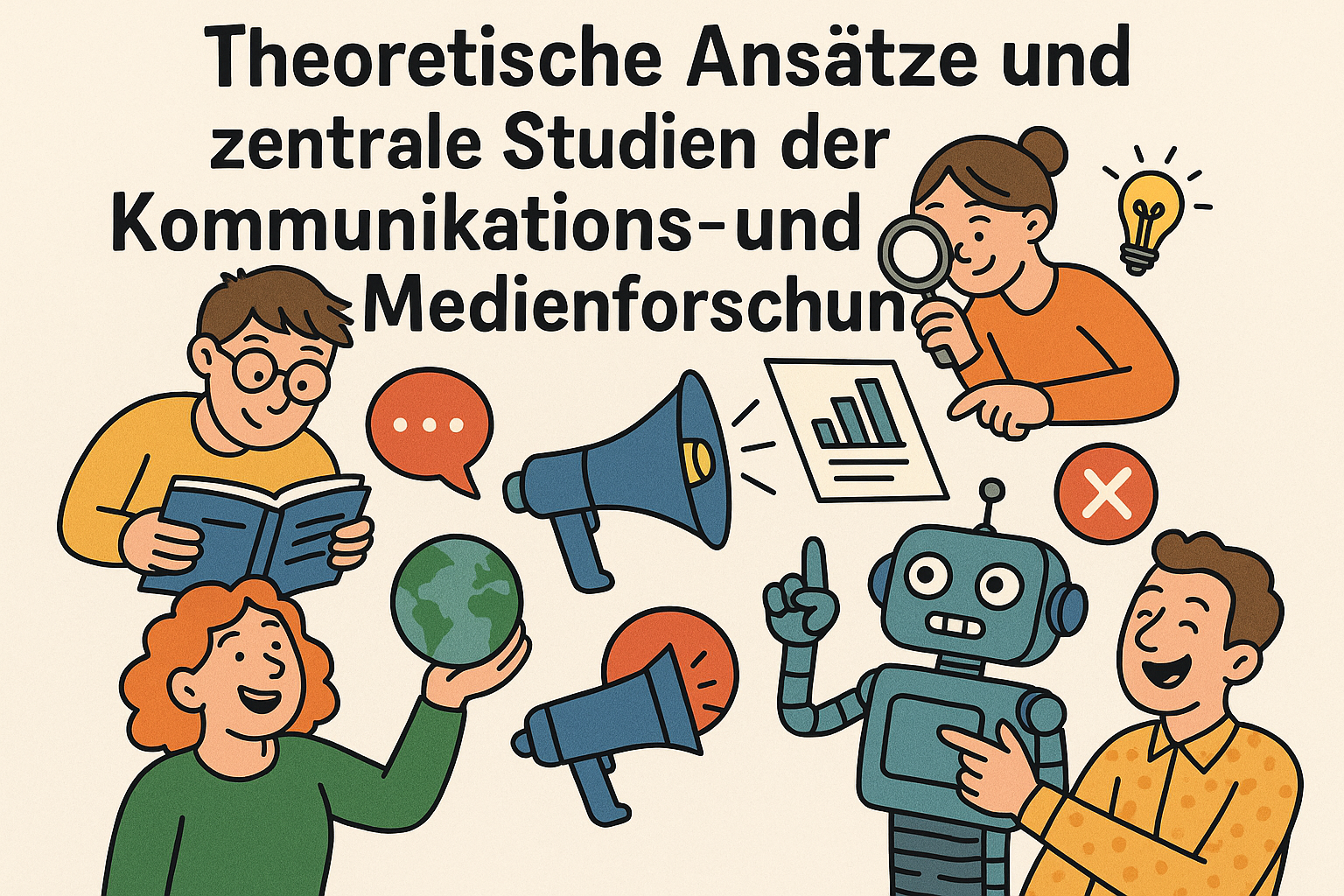
- Docente: Anne Reinhardt
- Docente: Benjamin Krämer
Reality-TV-Formate haben in den letzten Jahren wieder stark an Bedeutung gewonnen: Egal, ob es um die Suche nach der „echten“ Liebe geht (Bachelor, Bachelorette, Prince & Princess Charming), um Dating und Versuchung (AYTO, Temptation Island, Ex on the Beach) oder darum, die lieb gewonnen Reality-Stars in Spielen und Challenges (scheitern) zu sehen (Prominent Getrennt, Sommerhaus der Stars) – die Zuschauer*innen können mittlerweile aus einem ganzen Spektrum an Showformaten wählen.
Reality TV galt in Deutschland seit dem Erfolg von Big Brother (2000) und dem Dschungelcamp (2004) als besonders polarisierendes, aber zugleich besonders erfolgreiches Genre der TV-Unterhaltung. Während Kritiker*innen entsprechende Formate häufig als reines „Trash-TV“ abtun, erfreuen sie sich bei einem breiten Publikum großer Beliebtheit. War die Rezeption früher primär auf die Ausstrahlung im TV beschränkt, erstrecken sich Nutzungsprozesse durch die weite Verbreitung von Streaming-Diensten und die Allgegenwart von Social Media heute auf immer mehr Bereiche: So lässt sich das Geschehene einerseits auf den Social-Media-Profilen der Kandidat*innen nahezu in Echtzeit weiterfolgen, andererseits gibt es kommentierende und einordnende Formate wie Podcasts oder Reaction-Formate auf YouTube, die weitere Ebenen der Information, Unterhaltung und (kritischen) Auseinandersetzung ermöglichen.
Die Kommunikationswissenschaft hat gerade der jüngeren Tradition des Reality TV bislang jedoch kaum Beachtung geschenkt. Entsprechend ist nur wenig dazu bekannt, wer eigentlich (welche) Reality-Formate schaut, welche Motive die Rezeption anleiten und wie Nutzer*innen das Gesehene einordnen und verarbeiten. Insbesondere die ‚Verlängerung‘ der Rezeption über Social-Media-Plattformen, Podcasts & Co. ist wenig untersucht. Im Rahmen des Seminars wollen wir uns daher mit Medienrezeption und -wirkung von Reality-TV-Formaten auseinandersetzen und eigene empirische Studien entwickeln, die aktuelle Fragestellungen in diesem Bereich adressieren. Ziel ist es, ein besseres Verständnis davon zu erlangen, warum und wie Reality TV genutzt wird und welche Wirkungen sich daraus ergeben.

- Docente: Anna Sophie Kümpel