Was bedeutet Familie? Was macht sie aus? Welche Gruppenkonstellationen gelten als Familie? Warum?
In dieser interdisziplinären Vorlesung werden mediale Familienbilder in aktuellen Filmen vorgestellt und aus unterschiedlichen Fachperspektiven besprochen. Der Fokus liegt auf der filmischen Aushandlung von Familie, auf der Inszenierung von inner- und außerfamilialen Interaktionen, auf der Bestimmung von Geschlechter- und Generationenbeziehungen. Dabei werden besonders das Vorkommen und die Funktion der zahlreichen Verweise auf religiöse Symbole, Praktiken und Tradierungsprozesse, die in filmischen Familienbildern eine prominente Stellung einnehmen, in den Blick genommen. Denn religiöse Gemeinschaften und Traditionen regulieren familiale Verbünde maßgebend mit und prägen die unterschiedlichen Lebensphasen von der Geburt bis zum Tod. Die filmische Familie kann damit ein Ort der Offenbarung, der Manifestation des Bösen oder des Ausbruchs aus einem Werte- und Normensystem sein.
Die Vorlesung erkundet die Rolle von Religion in der medialen Darstellung des Doing Family, indem sie Stimmen aus unterschiedlichen Disziplinen ins Gespräch bringt: Fachleute aus sozial- und kulturwissenschaftlichen Fächern debattieren mit Experten und Expertinnen aus dem Bereich von Film und Religion.

- Dozentin: Daria Pezzoli-Olgiati
Die Religionswissenschaft beschäftigt sich mit den Verflechtungen von Religion und Kultur, was einen tiefgehenden Einblick in die Geschichte und die heutige Gesellschaft eröffnet. Der Einfluss von Religion auf das Leben von Individuen und Gruppen, auf die Politik, die Medien, die Kunst und die Wirtschaft lässt sich in der Tagesaktualität nicht übersehen. Ob in Kriegen oder Demonstrationen für den Frieden, in Regierungswahlen, in Genderdebatten oder Blockbusterfilmen: Religion spielt stets eine zentrale, häufig ambivalente und mehrdeutige Rolle.
Religion ist also ein vielschichtiges Phänomen, das unterschiedliche Weltbilder und Praktiken umfasst. Religion ist herausfordernd und kontrovers.
Diese Einführung in die Religionswissenschaft bietet die Möglichkeit, das Phänomen «Religion» jenseits von Werturteilen als wesentlichen Bestandteil von Kulturen kennenzulernen. Dafür werden zentrale Themen, Ansätze und Theorien, mit denen Religion in ihrer Vielfalt und Komplexität wissenschaftlich untersucht wird, vorgestellt und kritisch reflektiert. Die Veranstaltung bietet eine faszinierende Reise in eine Disziplin, in der es sehr viel zu entdecken gibt.

- Trainer/in: Verena Eberhardt
- Trainer/in: Daria Pezzoli-Olgiati
Von Tradwifes zu Co-Parenting: Kaum ein Thema ist so breit und umstritten wie die Familie. Mediale Familienbilder stehen in einer Wechselwirkung mit den vielfältigen Formen, die diese Art der Gemeinschaft in der heutigen Gesellschaft charakterisieren. Dabei wird Familie als dynamische Größe verstanden, die sich in komplexen inner- und außerfamilialen Beziehungen konstituiert und stets ausgehandelt und verändert wird.
In diesem Blockseminar beschäftigen wir uns mit der medialen Dimension von Familie, insbesondere in Kurzfilmen, TV-Serien, Werbespots und sozialen Medien. Wir fragen, wie Medien gesellschaftliche Ideen von Familie aufnehmen, sie transformieren und utopische sowie dystopische Szenarien entwerfen, die wiederum einen Einfluss darauf haben, was man heute unter „Familie“ versteht.

- Trainer/in: Daria Pezzoli-Olgiati
Was bedeutet es heute, kulturwissenschaftliche Religionswissenschaft zu betreiben? Im Forschungsseminar rekonstruieren wir die wesentlichen forschungshistorischen Etappen der kulturwissenschaftlichen Analyse von Religion und überlegen, welche Aspekte dieser Richtung für aktuelle Fragen relevant sind und wie wir sie für eine zeitgemäße Religionsforschung rezipieren können. Diese Reflexion richtet sich an alle, die Qualifikationsprojekte auf allen Stufen schreiben, sowie an weitere Interessierte, die über die komplexen Interaktionen von Religion, Kultur und Wissenschaft nachdenken möchten.
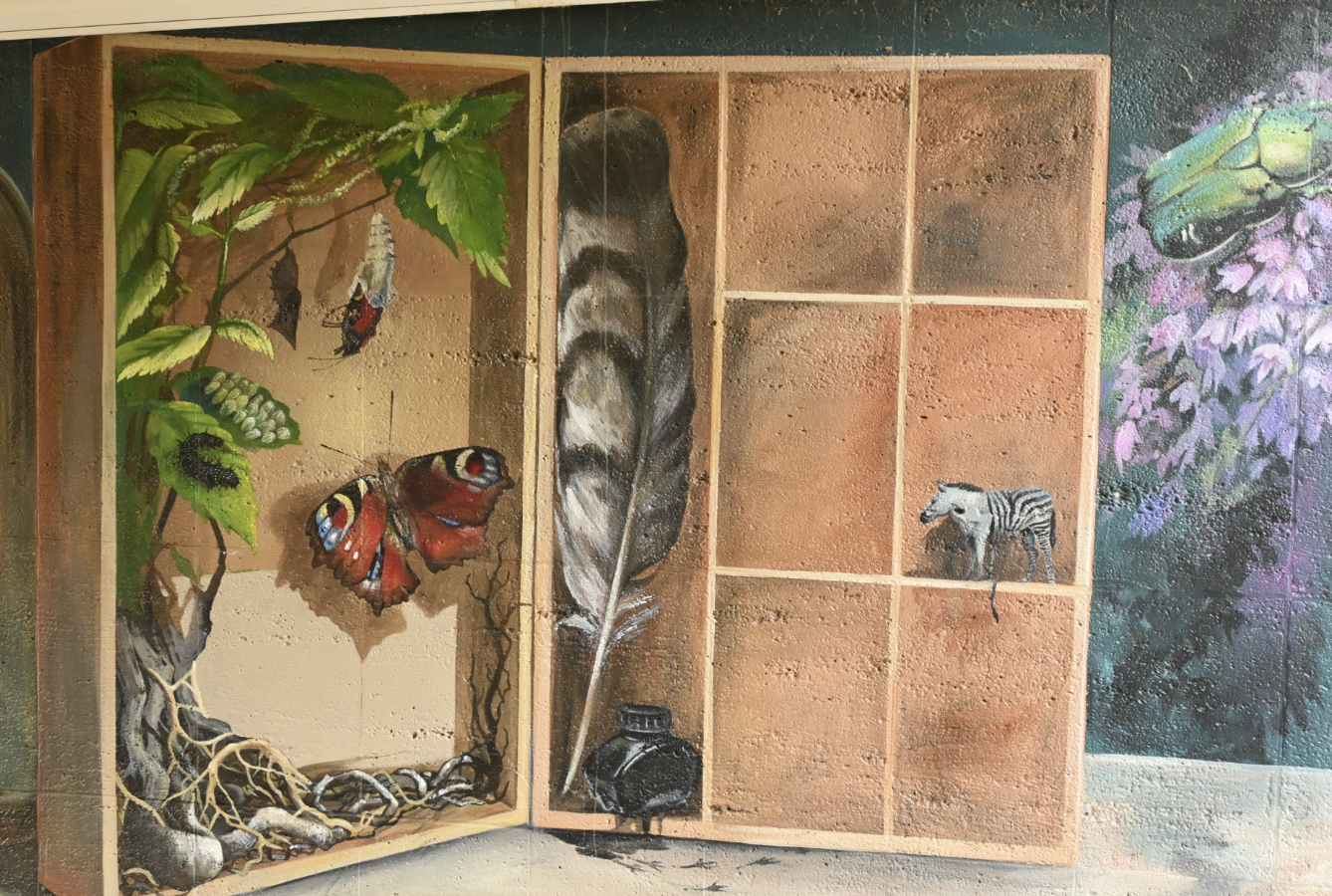
- Trainer/in: Verena Eberhardt
- Trainer/in: Anna Hepting
- Trainer/in: Anna-Katharina Höpflinger
- Trainer/in: Caroline Kloos
- Trainer/in: Luise Merkert
- Trainer/in: Jochen Mündlein
- Trainer/in: Daria Pezzoli-Olgiati
- Trainer/in: Johann Pitz
- Trainer/in: Anne Sachs
- Trainer/in: Renate Strassner
Dieses Seminar ist in Kombination mit der Vorlesung „Was ist Religion? Eine Einführung in die Religionswissenschaft“ konzipiert. Die Veranstaltung vermittelt einerseits Grundkenntnisse des wissenschaftlichen Arbeitens im Bereich der Religionswissenschaft. Andererseits bietet sie die Möglichkeit, die Literaturliste der Vorlesung gemeinsam zu besprechen und die darin beschriebenen Themen und Ansätze zu rekapitulieren.
- Dozentin: Anna Hepting
Religion und Macht sind auf vielfältige Weise miteinander verflochten. Dieses Seminar untersucht die Dynamiken, in denen religiöse Institutionen und Akteur:innen mit Machtstrukturen in Gesellschaft, Politik und Kultur interagieren. Im Zentrum stehen Fragen wie: Wie wird religiöse Autorität legitimiert? Welche Rolle spielt Religion bei der Stabilisierung oder Infragestellung von Machtverhältnissen? Wie äußert sich religiöse Macht im Vergleich zu politischer Macht? Und welche Bedeutung kommt dabei Medien und genderspezifischen Dimensionen zu? Anhand theoretischer Texte, historischer wie aktueller Fallbeispiele setzen wir uns mit den Formen, Funktionen und Folgen von Macht in religiösen Kontexten auseinander. Ziel des Seminars ist es, ein kritisches Verständnis für die Wechselwirkungen zwischen Religion und Macht zu entwickeln und eigene Fragestellungen im Spannungsfeld von Religion, Autorität, Gesellschaft und Kultur zu formulieren. Das Seminar umfasst die Lektüre theoretischer Texte sowie die Analyse von Fallbeispielen und medialen Darstellungen. |
- Dozentin: Marie-Therese Mäder
Der Tod betrifft alle Menschen. Seine Unausweichlichkeit ist unbestritten. Die Meinungen und Vorstellungen, was nach dem Tod kommt, gehen jedoch weit auseinander.
Sind Nahtod-Erfahrungen bereits ein Indiz für das Danach? Welche Hoffnungsräume werden für das nachtodliche Schicksal eröffnet?
Das Seminar befasst sich mit dem Panorama von Jenseitsvorstellungen in den großen Religionen und in neuen religiösen Bewegungen. Ins Zentrum rücken schließlich auch Fragen, wie mit den Toten in den unterschiedlichen Religionen umgegangen wird.
- Dozent: Matthias Pöhlmann
|

- Dozentin: Anna-Katharina Höpflinger
Im Seminar wird eine Einführung in qualitative Interviewtechniken für die Religionsforschung gegeben. Dies geschieht anhand des Erarbeitens ausgewählter methodischer Zugänge wie unterschiedlicher Interviewarten, des Führens informeller Gespräche, der Oral History sowie Transkriptions- und Kodierungsmöglichkeiten.
Ziel der Lehrveranstaltung ist ein Kennenlernen unterschiedlicher sozialempirischer qualitativer Interviewtechniken, ihrer jeweiligen Chancen und Grenzen sowie ihrer Kombinationsmöglichkeiten. Einen Teil des Seminars wird eine Vertiefung einer ausgewählten Methode anhand einer eigenen Studie bilden.
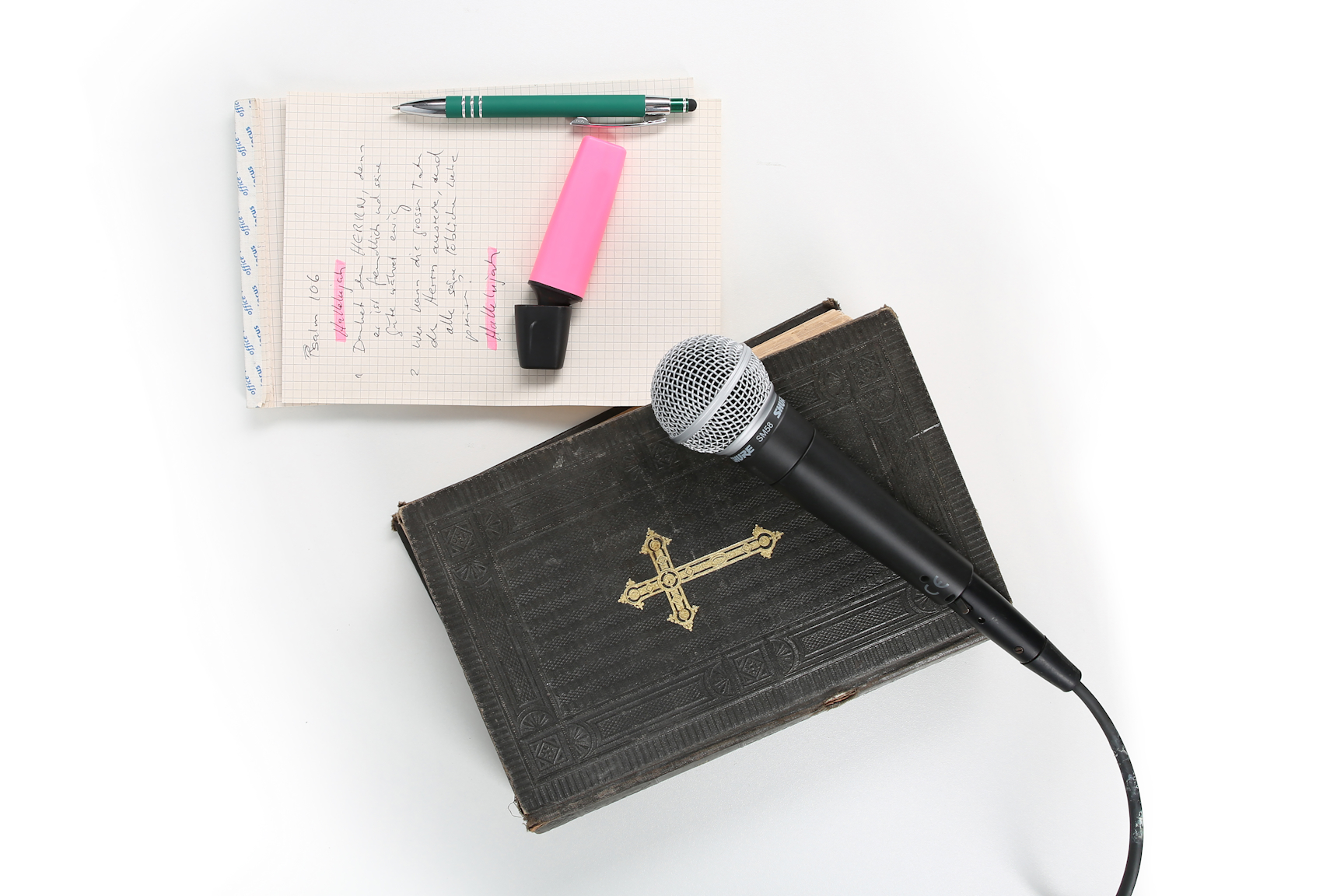
- Dozentin: Anna-Katharina Höpflinger