How do emotions shape the way we connect — or clash — online? Social media platforms like TikTok and Instagram thrive on emotional content. Emotions play a central role in driving engagement, shaping narratives, and fueling intergroup dynamics in digital spaces. In this seminar, we will explore how emotions influence online interactions between social groups, examining the potential risk of deepening divides.
Students will learn the full cycle of conducting a scientific research study, using an experiment as the method. The aim is to define a research topic, formulate central research questions and hypotheses, identify and integrate relevant literature and theories, design and implement the experiment, analyze data, and present findings. All individual steps should result in a coherent research paper at the end of the course. The course familiarizes students with key aspects of scientific work, including literature search, citation, scientific writing and presentation, understanding experimental research logic and design, and engaging in constructive peer feedback.

- Trainer/in: Ruta Kaskeleviciute
Medien repräsentieren, produzieren und reproduzieren soziale Diskurse und fungieren damit als zentrale gesellschaftliche Bedeutungsproduzenten. Sie wirken als „normalisierendes Forum für die soziale Konstruktion der Wirklichkeit“ (Fürsich, 2010, S. 113; eigene Übersetzung) und vermitteln soziales Wissen. Dabei organisieren sie sowohl Möglichkeiten der Teilhabe als auch Formen der Zugehörigkeit und des Ausschlusses.
Social Media Plattformen gelten häufig als Räume niedrigschwelliger Partizipation. Sie scheinen es zu ermöglichen, sich hegemonialen Ordnungen, wie sie durch institutionalisierte Medien reproduziert werden, zu entziehen und gleichberechtigt medial teilzuhaben. Bewegungen wie #BlackLivesMatter oder #MeToo, die über Social Media Aufmerksamkeit für strukturelle Ungleichheiten und soziale Ungerechtigkeit generieren, scheinen dieses Potenzial zu bestätigen. In solchen Argumentationen werden jedoch neoliberale Plattformlogiken, Zugangsbarrieren und soziale Machtverhältnisse oft ausgeblendet.
In diesem Kurs setzen wir uns kritisch mit Formen medialer (Selbst-)Repräsentation auf Social Media Plattformen auseinander. Aus einer dekolonialen Forschungsperspektive untersuchen wir, inwiefern über soziale Medien gesellschaftliche Teilhabe gefördert und ein Umdenken hinsichtlich struktureller Ungleichheiten angestoßen oder bestehende Machtverhältnisse fortgeschrieben werden.
Methodisch orientieren wir uns an der Kritischen Diskursanalyse nach Machin & Mayr und fragen, wie soziale Machtverhältnisse in medialen Repräsentationen stabilisiert oder infrage gestellt werden können. Ein zentrales Anliegen der Kritischen Diskursanalyse ist die Reflexion der eigenen Verstrickung in gesellschaftliche Machtverhältnisse und der daraus resultierenden Privilegien. Entsprechend befassen wir uns im Kurs nicht nur mit Medieninhalten, sondern auch mit dem Forschungsprozess selbst und der Rolle der*des Forschenden darin. Diese Perspektiven setzen die Studierenden in eigenen empirischen Forschungsprojekten um.
Einige der im Kurs behandelten Texte sind in englischer Sprache verfasst. grundlegende Englischkenntnisse und die Bereitschaft, englischsprachige Fachliteratur zu lesen, werden daher erwartet.- Trainer/in: Ana-Nzinga Weiß
Unser Alltag ist geprägt durch die Kommunikation mit anderen Menschen und die Nutzung vielfältiger Medienangebote. Doch was ist das eigentlich – Alltag? Im ersten Teil des Seminars nähern wir uns theoretisch an dieses Konzept an. Im zweiten Teil des Seminars setzen wir uns damit auseinander, wie man alltägliche Kommunikation und Mediennutzung empirisch erfassen kann. (Wie) können wir Menschen danach fragen? Oder müssen/dürfen wir sie dabei beobachten? Welche methodischen Möglichkeiten liegen zwischen Befragung und Beobachtung? Im dritten Teil des Seminars führen die Studierenden ein eigenes Forschungsprojekt durch; hierzu stehen verschiedene Themen zur Auswahl.
- Trainer/in: Lyn Ermel
- Trainer/in: Paula Fink-Stehr
Fake News werden als eine der größten Gefahren für unsere Demokratie gehandelt, da sie durch die Verfestigung von Falschwissen eine informierte Entscheidungsfindung erheblich beeinträchtigen. Eine zentrale Frage in der medienpsychologischen Forschung ist daher: Wie können wir Menschen gegen Fake News „immunisieren“? Im Seminar werfen wir zunächst einen Blick auf verschiedene theoretische Ansätze, die Menschen darin befähigen sollen, Online-Inhalte kritisch zu bewerten. Hierunter fallen unter anderem auch Serious Games: In diesen Spielen schlüpfen die Spieler:innen auf humorvolle Weise in die Rolle eines Unruhestifters und lernen durch aktive Anwendung die Merkmale von Fake News kennen. Doch stärken diese Spiele wirklich die Fake News Resilienz? Und wie nehmen die Spieler:innen eigentlich solche Spiele wahr? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigen wir uns nach der theoretischen Einführung in den Forschungsstand im praktischen Teil des Seminars. Hier sollen die Studierenden mittels qualitativer Methoden (Interviews) nicht nur den Umgang mit Fake News generell, sondern auch die Wahrnehmung und empfundene Wirksamkeit des Serious Games „SchlaWiener – Entkomm dem Fake News Kommissar“ (www.fakenewskommissar.eu) unter die Lupe nehmen. In Kleingruppen werden hierbei die einzelnen Schritte des empirischen Forschungsprozesses durchlaufen – von der Formulierung von Forschungsfragen über die Konzeption und Durchführung einer Studie bis hin zur Auswertung der gesammelten Daten.
- Trainer/in: Anne Reinhardt
Wie finden Menschen mit chronischen Erkrankungen heraus, was „richtig“ für sie ist? In diesem Forschungsprojekt geht es um die sozialen und medialen Einflüsse auf das Selbstmanagement chronischer Krankheiten. Familie, Freund*innen, Ärzt*innen, Selbsthilfegruppen – aber auch Medfluencer auf TikTok oder Instagram – alle können Einfluss darauf nehmen, wie Betroffene ihre Krankheit wahrnehmen und damit umgehen.
Wir entwickeln qualitative Forschungsarbeiten und analysieren dabei die Relevanz von sozialen und persönlichen Normen für das Selbstmanagement chronischer Krankheiten. Dafür können leitfadengestützte Interviews mit Betroffenen oder Expert*innen oder auch eine qualitative Netzwerkanalyse durchgeführt werden. Der Fokus liegt auf chronischen Erkrankungen im Allgemeinen. Welche Krankheiten wir in den Blick nehmen, entscheiden wir gemeinsam im Plenum.
Durch die Verbindung theoretischer Auseinandersetzung mit praktischer Forschungsarbeit fördert das Seminar sowohl ein vertieftes Verständnis sozialer Normbildungsprozesse als auch die methodische Kompetenz im Bereich der qualitativen Gesundheitsforschung.
- Trainer/in: Rebecca Kammerer
- Trainer/in: Claudia Riesmeyer-Lorenz
Fake News stellen derzeit eine der größten Gefahren für unsere Demokratie dar, da sie durch die Verfestigung von Falschwissen eine informierte Entscheidungsfindung erheblich beeinträchtigen. Eine zentrale Frage in der medienpsychologischen Forschung ist daher: Können wir Menschen durch Medienbildung gegen Fake News „immunisieren“? Im Seminar werfen wir zunächst einen Blick auf verschiedene theoretische Ansätze, die Menschen darin befähigen sollen, Online-Inhalte kritisch zu bewerten. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Einsatz von Serious Games: In diesen Spielen schlüpfen die Spieler:innen auf humorvolle Weise in die Rolle eines Online-Unruhestifters und lernen durch aktive Anwendung die Merkmale von Fake News kennen. Doch stärken diese Spiele wirklich die Fake News Resilienz? Sind Games als Lernmaterialien ausreichend, oder sollten sie mit anderen Interventionsarten kombiniert werden, wie zum Beispiel Civic Online Reasoning? Und wie können wir den Erfolg von Fake News-Interventionen überhaupt sinnvoll messbar machen? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigen wir uns nach der theoretischen Einführung in den Forschungsstand im praktischen Teil des Seminars. Konkret werden wir mithilfe quantitativer Methoden (Befragung & Experiment) die Wirksamkeit des Serious Games „SchlaWiener – Entkomm dem Fake News Kommissar“ (www.fakenewskommissar.eu) im Vergleich zu anderen Interventionsansätzen unter die Lupe nehmen. In Kleingruppen werden hierbei die einzelnen Schritte des empirischen Forschungsprozesses durchlaufen – von der Formulierung von Forschungsfragen und Hypothesen über die Konzeption und Durchführung einer Studie bis hin zur Auswertung der gesammelten Daten.
- Trainer/in: Anne Reinhardt
- Trainer/in: Victoria Ertelthalner-Nikolaev
Die emotionalisierte politische Kommunikation hat durch Social-Media-Plattformen wie TikTok und Telegram eine neue Dynamik erhalten. Im Kontext der US-Wahlen ist davon auszugehen, dass auch deutsche Politiker:innen emotionale Botschaften nutzen werden, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und ihre politischen Standpunkte zu vermitteln. In diesem Seminar untersuchen wir, welche Rolle Emotionen in der politischen Kommunikation haben und untersuchen deren Einsatz in einem konkreten Kontext. Wir beleuchten theoretische Ansätze zu Emotionen in der Politik und analysieren die Rolle und Ausprägungen emotionaler Inhalte auf TikTok und Telegram. Im praktischen Teil des Seminars wenden wir quantitative Methoden an, um die Kommunikationsstrategien deutscher Politiker zu den US-Wahlen auf diesen Plattformen zu untersuchen. Dabei durchlaufen wir wesentliche Schritte des empirischen Forschungsprozesses: von der Formulierung von Forschungsfragen und Hypothesen bis hin zur Auswertung und Interpretation der Ergebnisse. Ziel ist es, ihnen den gesamten Forschungsprozess näherzubringen und das Verständnis für die Rolle von Emotionen in der politischen Kommunikation sowie deren Einfluss auf demokratische Prozesse zu vertiefen.
- Trainer/in: Simon Greipl
- Trainer/in: Heidi Schulze
Wissenschaftliche
Evidenz, d.h. wie (un)gesichert wissenschaftliche Ergebnisse sind, wird nicht
erst seit aber zunehmend durch eine stärkere öffentliche Auseinandersetzung mit
Themen wie dem Klimawandel und COVID-19 diskutiert. Bspw. stehen Fragen im Raum
danach welche Maßnahmen effektiv gegen die Klimakrise helfen oder wie sicher
Impfungen sind. Aktuell erfahren auch viele Entwicklungen rund um das Thema
Künstliche Intelligenz eine Diskussion um wissenschaftliche Evidenz. In der
Kommunikation über wissenschaftliche (Un)Gesichertheit treffen verschiedenste
Akteur*innen mit unterschiedlichen Rationalitäten und Zielen aufeinander, wie
Wissenschaftler*innen, Politiker*innen, Journalist*innen, Influencer*innen und
Rezipierende. Daraus resultieren verschiedene Formen der Evidenzkommunikation,
darunter auch solche die speziell Ungesichertheit entweder dramatisieren oder
herunterspielen. Und diese verschiedenen Evidenzdarstellungen wiederum können
unterschiedliche Wirkungen hervorrufen, u.a. auf Vertrauen in oder Interesse an
der Wissenschaft bis hin zu Verhaltensintentionen/-weisen. Deshalb soll sich in
dieser Lehrveranstaltung der Rolle von Evidenz in der Risiko- und
Wissenschaftskommunikation genähert werden. Dazu werden die entsprechende
bisherige Literatur aufgearbeitet, ein theoretischer Rahmen gewählt und
Forschungsfragen formuliert. Diese werden dann in ein Forschungsdesign und
-instrument überführt (methodisch offen, gern auch visuelle/multimodale
Aspekte), Daten erhoben und schließlich ausgewertet.
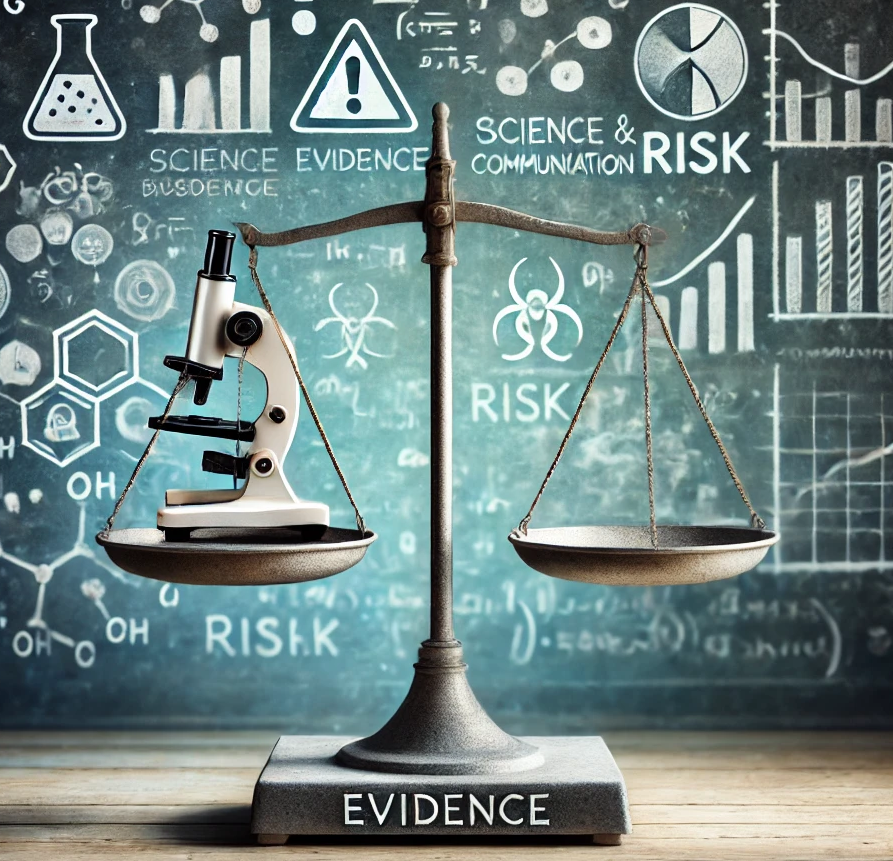
- Trainer/in: Lars Guenther
Soziale Netzwerke sind nicht nur Orte, an denen wir Zeit verbringen, uns informieren und unterhalten. Sie werden von verschiedenen Akteursgruppen für strategische Kommunikation genutzt. Wir wollen uns im Forschungsprojekt mit der Wahrnehmung dieser strategischen Kommunikation aus verschiedenen theoretischen und empirischen Perspektiven beschäftigen. Vorstellbar ist beispielsweise ein Fokus auf die Wahrnehmung strategischer Kommunikation von Influencer*innen, Unternehmen oder Rezipient*innen. Der konkrete Fokus des Forschungsprojektes hängt ebenso wie das methodische Design vom Interesse der Teilnehmer*innen ab und wird gemeinsam im Laufe des Wintersemesters entwickelt.
- Trainer/in: Jessica Kühn
- Trainer/in: Claudia Riesmeyer-Lorenz
In various democratic states, from France to Florida, legislation is being passed to more strictly regulate internet content, including legal online pornography. In this seminar we will explore the need for such legislation and what it aims to do and how. We will then analyse online audience data from various US states to examine the effects of such legislation. We will attempt to find out whether mandatory age verification for porn sites has reduced their consumption, including by under-18s. In this seminar you will learn about the changing regulation of internet content, how internet audiences are measured, how to analyse online audience data, and the quasi-experimental methodology of ‘interrupted time series analysis’.
- Trainer/in: Liselotte Drescher
- Trainer/in: Florian Stalph
- Trainer/in: Florian Stalph
- Trainer/in: Sina Thäsler-Kordonouri
- Trainer/in: Neil Thurman