- Docente: Maria-Elisabeth Clar
- Docente: Ivo Frankenreiter
- Docente: Markus Vogt
- Docente: Ivo Frankenreiter
- Docente: Caroline Herrmann
- Docente: Markus Vogt
- Docente: Caroline Herrmann
- Docente: Markus Vogt
- Docente: Werner Veith
- Docente: Ivo Frankenreiter
- Docente: Caroline Herrmann
- Docente: Markus Vogt
- Docente: Ivo Frankenreiter
- Docente: Caroline Herrmann
- Docente: Lisa Riller
- Docente: Markus Vogt
- Docente: Burkhard Berkmann
- Docente: Ivo Frankenreiter
- Docente: Stefanie Siemens
- Docente: Markus Vogt
Gegenwärtig scheint die Zukunft der Demokratie gefährdet, sei es durch das Erstarken des Populismus und autoritärer Regime weltweit, durch die emotionalisierende Eigendynamik digitaler Debatten oder durch eine mangelnde Durchsetzungskraft gegenüber wirtschaftlicher Macht. Leben wir bereits in der „Post-Demokratie“ (Crouch) und der „simulativen Demokratie“ (Blühdorn)? Was sind die Ursachen für die weltweite „Verlockung des Autoritären“ (Appelbaum) und den postfaktischen Irrationalismus vieler „Querdenker“? Kann die Demokratie auch in Zukunft weltweit Freiheit, Frieden und Wohlstand garantieren? Woran liegt es, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in dem Friedensprojekt Europa gegenwärtig so schwach erscheint? Brauchen wir eine „Republik Europa“? Welche Rolle spielt die christliche Kultur für die europäische Identität? Welche Rolle kommt Nationalstaaten im Spanungsfeld zwischen nationalen Interessen und europäischem sowie globalem Gemeinwohl zu?
Um in diesen aktuellen Debatten Orientierung zu finden, ist es hilfreich, sich der ethischen, theologischen und gesellschaftstheoretischen Grundlagen der Politischen Philosophie zu vergewissern. Lassen sich aus den Klassikern der Staatslehre (Platon, Aristoteles, Hobbes, Locke u.a.) noch heute gültige Kriterien für eine gute und gerechte Gesellschaft ableiten? Wie ist das Verhältnis von Macht und Moral in der Politik? Sind die Menschenrechte Vehikel säkularer Ethik oder zentrale Wertgrundlage christlicher Politik? Wie lässt sich Toleranz als „Tugend der Demokratie“ (Forst) von Gleichgültigkeit gegenüber moralischen Überzeugungen und Wahrheitsfragen abgrenzen? Sind die Kirchen „Moralagenturen“ (Joas) für den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Was ist der Mehrwert „Öffentlicher Theologie“ für eine politische Ethik? Wo liegen Aufgaben, Chancen und Grenzen kirchlicher Kompetenz in der Mitgestaltung des gesellschaftlichen Wandels?
- Docente: Ivo Frankenreiter
- Docente: Caroline Herrmann
- Docente: Markus Vogt
- Docente: Ivo Frankenreiter
- Docente: Oliver Putz
- Docente: Lisa Riller
- Docente: Stefanie Siemens
- Docente: Markus Vogt
- Docente: Stefanie Siemens
- Docente: Markus Vogt
- Docente: Burkhard Berkmann
- Docente: Andreas Rentz
- Docente: Markus Vogt
- Docente: Andreas Rentz
- Docente: Markus Vogt
- Docente: Andreas Rentz
- Docente: Markus Vogt
- Docente: Ivo Frankenreiter
- Docente: Andreas Rentz
- Docente: Markus Vogt
Viele populäre Spielfilme thematisieren ethische Fragestellungen, indem sie Geschichten von Freundschaft, Hass und Liebe, von Leid, Krankheit und Tod, von Moral und Unmoral, von Schuld und Sühne oder auch von der Sehnsucht nach Erlösung erzählen. Dabei werden häufig am Beispiel einzelner Figuren Problemlagen dargestellt, die die basalen Fragen der individuellen menschlichen Existenz sowie des sozialen Zusammenlebens aufgreifen und unter der Rücksicht von „gut“ und „böse“ beantworten.
In der Veranstaltung werden populäre Spielfilme einer ausführlichen Filmanalyse unterzogen und die jeweiligen ethischen Themenstellungen systematisch vertieft diskutiert.
- Docente: Werner Veith
Im Synodalen Weg werden vor dem Hintergrund der Aufarbeitung der Skandale um den sexuellen Missbrauch Brennpunkte aktueller theologischer und kirchlicher Debatten verhandelt, in denen sehr unterschiedliche Positionen aufeinandertreffen. Die vier Themenfelder sind: Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft, Priesterliche Existenz heute (Verhältnis Kleriker und Laien), Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche (Geschlechtergerechtigkeit) und als verbindendes Querschnittsthema Macht und Gewaltenteilung in der Kirche.
Diese Themenfelder werden im Seminar aus kirchengeschichtlicher und sozialethischer Perspektive beleuchtet. Zu behandeln ist, in welchen Punkten Verständigung gelingen kann und um der Zukunft der Kirchen willen gelingen sollte, wo Dissens wohl bleiben wird, wo Kompromisse möglich sind, welche Widerstände und theologischen Konfliktlinien sich abzeichnen. Systematisch ist zu fragen, ob es innere Zusammenhänge der vier Themenfelder gib und wie die unterschiedlichen Argumente historisch, ethisch und theologisch einzuordnen sind. Dafür werden Texte der aktuellen Diskussion in den vier Foren des synodalen Weges sowie theologische Analysen gelesen und diskutiert.

- Docente: Franz Bischof
- Docente: Annika Fürst
- Docente: Felix Geyer
- Docente: Viola Kohlberger
- Docente: Andreas Rentz
- Docente: Markus Vogt
- Docente: Alessandra Moraldi
- Docente: Markus Vogt
Wirtschaftsethische Reflexionen kreisen um den moralischen Wert und die Grenzen des Marktes. Fragen dazu sind wieder verstärkt ins öffentliche Bewusstsein getreten. Zum einen werden die Deregulierung der Arbeitswelt und die „Vermarktlichung“ der Gesamtgesellschaft problematisiert. Zum anderen nehmen die Suchbewegungen nach alternativen Wirtschaftsformen zu. Soziale Bewegungen, die sich unter Überschriften wie Gemeinwohl-Ökonomie oder Postwachstum entwickeln, sind Beispiele dafür. Die einen verteidigen den freien Markt als zentrale Form der Koordinierung des Wirtschaftslebens, die anderen wollen ihn einschränken und zähmen, wenn nicht gar „transformieren“.
Themen der Vorlesung werden u.a. sein: Zuordnungen von Ökonomie und Ethik; Wettbewerb als Entdeckungsverfahren; Konkurrenz. Antipode zu Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Kooperation?, das Ordnungsmodell der Sozialen Marktwirtschaft; Sozialstaat; die Wirtschaftskritik von Papst Franziskus; anthropologische, theologische und gesellschaftstheoretische Grundlagen der Gerechtigkeit; wirtschaftsethische Ansätze der katholischen Soziallehre; Prekarisierung der Arbeitswelt; die Bewertung von Wirtschaftswachstum; Philosophie des Geldes; Unternehmensethik, Konsumethik.

- Docente: Rana Bose
- Docente: Alessandra Moraldi
- Docente: Andreas Rentz
- Docente: Markus Vogt
Herzlich Willkommen zu den Aktuellen Themen der Umweltethik.
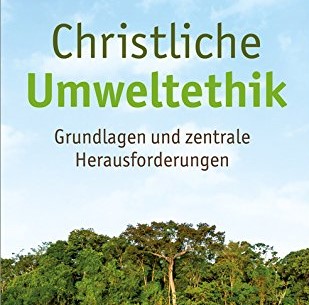
- Docente: Felix Geyer
- Docente: Alessandra Moraldi
- Docente: Markus Vogt
- Docente: Michael Weweler
Im Seminar geht es zunächst darum, sich die Grammatik ethischer Reflexion anzueignen und über deren pädagogische Implikationen zu reflektieren. Dabei geht es auch darum ein Bewusstsein für die Verhältnisbestimmung von allgemein ethischen Fragen im Kontext des schulischen Religionsunterricht zu entwickeln.
Neben einer allgemeinen Einführung in klassische Formen der Bestimmung der Maßstäbe 'guten Handelns' (Tugendethik, Pflichtethik, Utilitarismus, Vertragsethik, Diskursethik), grundsätzlicher Klärung des ethischen Stellenwerts von Begriffen und Artikulationen, sowie Bestimmungen von dem, was und wie Normativität in (Geistes-)Wissenschaft und Alltag eine Rolle spielt, wird es darum gehen, dass Studierende sich zentrale ethische Begriffe wie Solidarität, Frieden, Toleranz, Gerechtigkeit, etc. aneignen und gemeinsam erarbeiten.
Im nächsten Schritt erarbeitet das Seminar verschiedene Modelle zur Förderung einer entsprechenden ethisch-moralischen Urteilskraft im Religionsunterricht. Dabei werden verschiedene Lernwege (z.B. narrativ-ethisches Lernen, Lernen an Biographien, Dilemma-Diskussion, Gedankenexperiment usw.) kritisch beleuchtet, in unterrichtspraktischen Einheiten an einem lehrplankonformen Beispiel erprobt und schließlich in einen Gesamtzusammenhang gebracht.

- Docente: Felix Geyer
- Docente: Bernd Ziegler
Menschenrechte sind die Grundlage der Demokratie; Ihr Verhältnis zum christlichen Glauben ist vielschichtig: einerseits haben sie in der biblischen „Demokratisierung der Gottebenbildlichkeit“, der Idee der unsterblichen Seele, der Gewissens- und Religionsfreiheit sowie dem Prinzip der unbedingten Liebe ihre zentrale Wurzel; zugleich wurden sie von der Katholischen Kirche erst 1963 (in der Enzyklika „Pacem in terris“) offiziell anerkannt; bis heute ist der Stellenwert der Menschenrechte in der katholischen Kirche in einigen Bereichen (z.B. Frauenrechte) umstritten. Ist der mit den Menschenrechten verbundene „Kult des Individuums“ die säkularisierte „Religion der Moderne“?
Darüber hinaus wird das Seminar folgende Aspekte diskutieren:
- Zusammengehörigkeit von Rechten und Pflichten,
- Kinderrechte,
- Rechtansprüche von Menschen mit Behinderung (Inklusion),
- Grenzen und Umsetzungsdefizite in der Migrationsgesellschaft,
- Braucht es ökologische Menschrechte?
- Tierethische Erweiterung bzw. Revision der (anthropozentrischen) Menschenrechte
- Radikale Kritik des (digitalen) Trans- und Posthumanismus
- Religiöse u. kulturspezifische Zugänge zum Verständnis der Menschenrechte
Wegen der Coronakrise kann das Seminar mindestens in der ersten Semesterhälfte nicht als Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden.
Es werden für jeden Woche digital Texte, die zu erarbeiten sind, angeboten. Als Kurzreferate sollen Thesenpapiere und - nach Möglichkeit - Ton und/oder Bildaufnahmen von den TN erstellt werden.
Zusätzlich wird ein Diskussionsforum in Moodle angeboten, falls die Verbindung stabil ist und alle Zugang haben auch als virtuelles Seminar (LMU zoom-Video).

- Docente: Felix Geyer
- Docente: Alessandra Moraldi
- Docente: Markus Vogt
In dieser Einführungsvorlesung werden Grundlagen und Grundfragen der
christlichen Sozialethik behandelt. Neben historischen Zugängen und
zentralen Begriffserklärungen stehen besonders die normativen
Orientierungen des Faches, wie Personalität, Solidarität,
Subsidiarität, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit im Vordergrund. Die Vorlesung ist so
angelegt, dass anstehende Fragen in der Diskussion geklärt werden
können.
- Docente: Werner Veith