Einführung in die Soziologie (01)
14-16 Uhr ct.
Zoom-Meeting beitreten
https://lmu-munich.zoom.us/j/95117620749?pwd=TE5ETDFsQXlXMTE3QVlpV0krMTluQT09
Meeting-ID: 951 1762 0749
Kenncode: 627151
In diesem Kurs wird die qualitative Familiensoziologie eingeführt. Fragen der Reproduktion, Regeneration, Arbeitsteilung, Paarfindung, Liebe und Sexualität usw. finden hier unter dem Licht sozialer Differenzen wie Gender eingehende Beachtung. Es soll ein Querschnitt (aktueller) qualitativer Forschung ermöglicht werden.
Ziel ist es, dass die Studierenden einen Einblick gewinnen in zentrale qualitative Methoden und Fragestellungen innerhalb der Familiensoziologie und angrenzender (Teil–)Disziplinen.
Die Anmeldung für diese Veranstaltung ist ausschließlich über LSF möglich! Den Einschreibeschlüssel für den Moodle-Kurs erhalten Sie zu Semesterbeginn.
In diesem Kurs wird in Werk und die Theorie von Hartmut Rosa eingeführt. Fragen der Resonanz als Beziehung zur sozialen und dinglichen Welt, der Beschleunigung als Grundstruktur der Moderne und der Auswirkungen, die daraus erwachsen, werden eingehend betrachtet. Die Frage, wie Geschlecht bei Rosa gedacht werden kann, steht ebenfalls im Raum.
Ziel ist es, dass die Studierenden einen Einblick gewinnen in Rosas Theoriegebilde und Fragestellungen innerhalb der Soziologie damit bearbeiten können.
In der Übung stellen Absolventinnen und Absolventen ihre Abschlussarbeit zum jeweiligen Bearbeitungsstand vor. In der Gruppe werden die Untersuchungen und ihr Fortgang diskutiert. Dabei stehen – je nach Stand der Arbeit – Fragen der Themenspezifikation, Wahl der Methode, des strukturellen Aufbaus, der Literaturauswahl und schließlich der Interpretation der Ergebnisse im Vordergrund. Die von den Studierenden zu haltenden Vorträge ermöglichen die Festigung der eigenen Präsentationskompetenz und schulen die Fähigkeit zur Argumentation. Die anschließende Diskussion hilft, den eigenen Forschungsprozess kritisch zu reflektieren. Wesentliche Arbeitsschritte des wissenschaftlichen Arbeitens werden semesterbegleitend bedarfsgerecht vertieft. |
Einführung in die Soziologie (01)
14-16 Uhr ct.
Zoom-Meeting beitreten
https://lmu-munich.zoom.us/j/95117620749?pwd=TE5ETDFsQXlXMTE3QVlpV0krMTluQT09
Meeting-ID: 951 1762 0749
Kenncode: 627151

Als historische Grundbegriffe charakterisieren "Macht" und "Herrschaft" soziale, politische und kulturelle Beziehungen. Zugleich unterliegen diese Begriffe aber auch einem historischen Wandel, der nicht zuletzt
Das Seminar unternimmt den Versuch, den Wandel der Begriffe zu rekonstruieren, Idealtypen der Herrschaft zu differenzieren sowie konkurrierende Machtkonzeptionen vergleichend zu analysieren. Ins Zentrum rücken Max Webers Herrschaftssoziologie sowie die Machtkonzeptionen von Pierre Bourdieu und Michel Foucault.
Die Rational-Choice-Theorie ist ein sehr verbreiteter Ansatz in den Wirtschaft- und Sozialwissenschaften. In ihrem Fokus stehen Gründe und Folgen des menschlichen Verhaltens, die mit Entscheidungen zwischen konkurrierenden Alternativen in unterschiedlich strukturierten Situationen zu tun haben.
Die Rational-Choice-Theorie erlaubt die Deduktion von empirisch prüfbaren
Aussagen im Rahmen von Modellierungen. Daher werden die Varianten der Theorie
nicht nur vorgestellt und diskutiert, sondern durch Anwendungen aus der
Soziologie, Politikwissenschaft und Ökonomie veranschaulicht. Dabei sollen auch
Anomalien und Weiterentwicklungen des Ansatzes in den Blick genommen werden.
Das Modul „Datenerhebung“ führt in quantitative Forschungsdesigns und Datenerhebungsverfahren ein. Nach
einer Einführung in Grundlagen (Forschungsdesigns, Validität) werden unterschiedliche Designs vertieft: Klassi-
sche Designs wie Experimente und Surveys, einschließlich geeigneter Stichprobenverfahren, aber auch neuere
Verfahren, wie Studien mit „big data“ oder räumliche Analysen mit Georeferenzierungen. Studierende lernen
die Vorteile, aber auch Grenzen unterschiedlicher Designs praktisch anhand von Anwendungsstudien und
Übungsaufgaben kennen. Zudem können Sie Ideen für eigene Forschungsdesigns entwickeln.
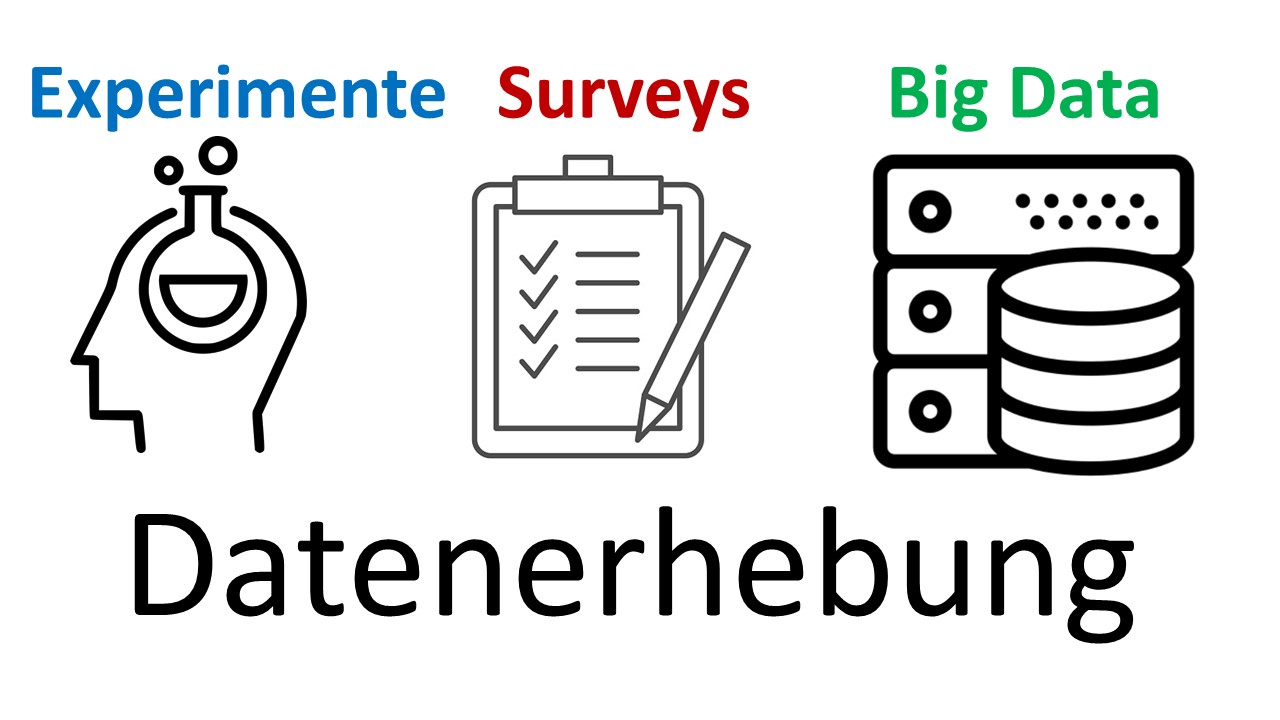
Supertutorium zu den Tutorien der Einführungs-Vorlesung in qualitative Methoden im WiSe 2021/22
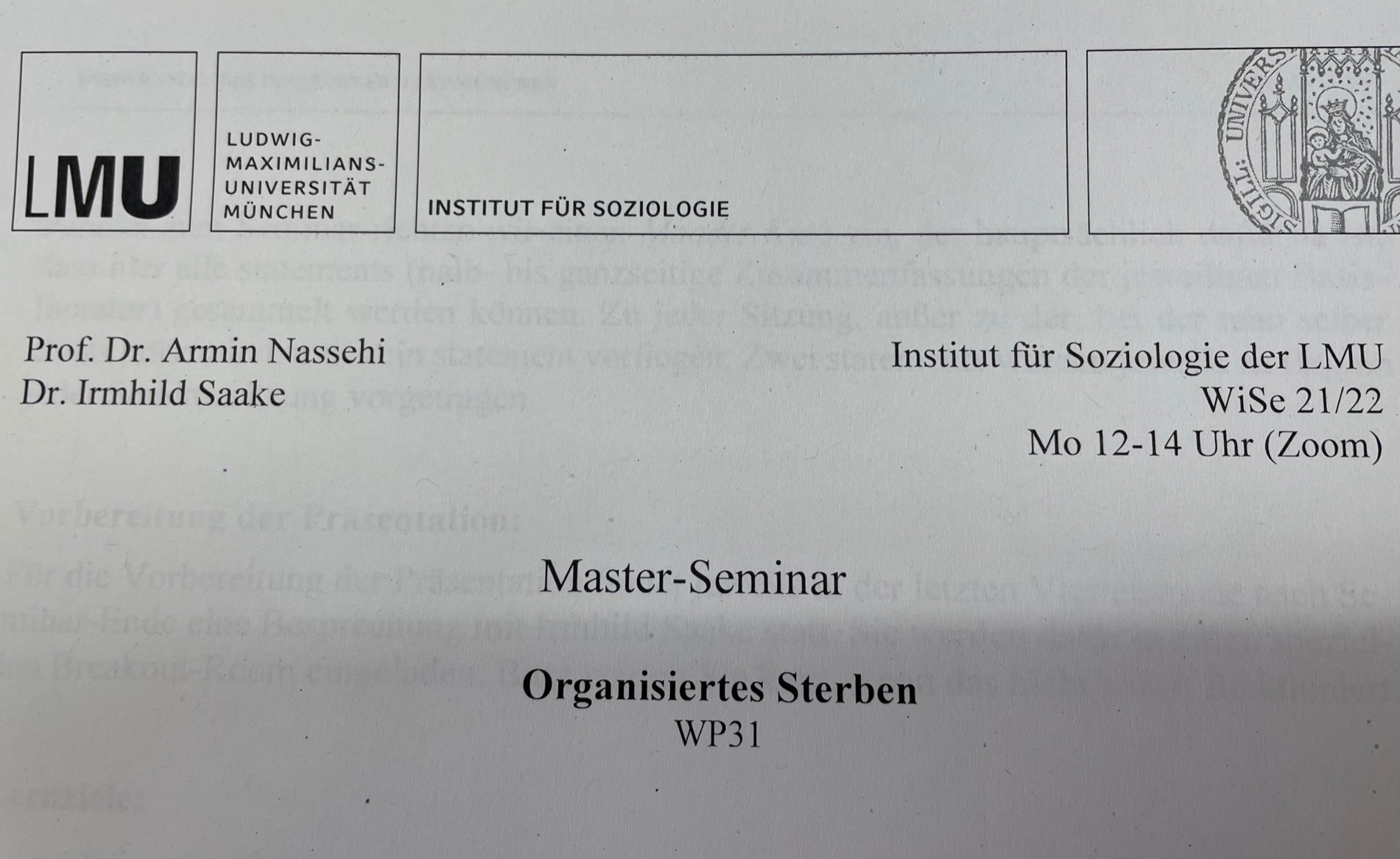
Das Tutorium wird sich aus zwei Einheiten zusammensetzen:
1) Jour fixe: Synchrone ZOOM-Sitzung
Donnerstag, 14.00-16.00 Uhr (c.t.)
Dabei wollen wir uns in einer gemeinsamen ZOOM-Sitzung mit grundlegenden Aspekten zum wissenschaftlichen Arbeiten befassen und uns über diesbezügliche Erfahrungen austauschen:
z.B.
- Wie funktioniert wissenschaftliches Arbeiten?
- Wie kann ich mich bereits während des Semesters auf Hausarbeiten vorbereiten?
- Wie finde ich ein Thema? Wie entwickle ich eine Fragestellung?
- Wie baue ich meine Arbeit auf?
- Wie suche und finde ich passende Literatur?
- Welche Formalia sollte ich beachten?
- Welche praktischen Tipps können mir das Vorgehen erleichtern?
- etc.
Um das Angebot an eure Bedürfnisse anpassen zu können, könnt ihr mir selbstverständlich jetzt im Vorfeld und jederzeit Fragen oder Wünsche per Mail zukommen lassen, auf die im Rahmen des Tutoriums eingegangen werden soll.
Für die ZOOM-Sitzungen werden wir folgende Zugangsdaten verwenden:
Thema: Tutorium zum wissenschaftlichen Arbeiten (Sprachwissenschaft)
Uhrzeit: 21. Oktober.2021 14:00 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien
Zoom-Meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/82822186014?pwd=SGp6VWhsdlBUaE9Xbm9Ka2xrdTMzZz09#success
Meeting-ID: 870 9600 5611
Kenncode: L2ng02st1k
Die Teilnahme am Tutorium ist freiwillig und es können keine ECTS-Punkte erworben werden.
Die wichtigsten Inhalte werden auf MOODLE (Zugangsdaten folgen) zur Verfügung stehen.
2) Individuelle Beratung:
Da womöglich manche von euch nicht am fixen Termin teilnehmen können, aber auch um noch genauer und individueller auf eure Arbeiten/Fragen eingehen zu können, stehe ich euch für virtuelle Einzelberatungen zur Verfügung, die wir in gemeinsamer Absprache vereinbaren können. Das gibt uns auch den Raum, um zusammen einen Blick auf eure Arbeiten zu werfen und spezielle Fragen zu klären.
Für Rückfragen stehe ich euch jederzeit zur Verfügung: sebastian.wittkopf@campus.lmu.de
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und den Austausch mit euch in diesem Wintersemester 2021/2022!

New tools powered by artificial intelligence (AI) are increasingly developed and deployed in (local) journalism. Against this background, understanding audiences’ perceptions of AI is essential, as the acceptance or rejection of AI in news production can translate into public trust or distrust in journalism (Robertson & Ridge-Newman, 2022). Indeed, there are concerns about accuracy, biases, and privacy, which can be subsumed under the headings of algorithmic appreciation (Joris et al., 2021) or algorithmic aversion (Mahmud et al., 2022).
This seminar will investigate AI's perceived benefits and drawbacks in local journalism by employing focus groups and interviews with audience members. A particular reference point will be the concept of algorithmic folk theories (Ytre-Arne & Moe, 2021) to explore the perceptions of AI in local journalism by different audiences.
Das Seminar widmet sich den
Veränderungen im politischen Diskurs der späten Sowjetunion und des
postsowjetischen Russlands, die mit dem Instrumentarium der klassischen,
aristotelischen Rhetoriklehre untersucht werden sollen. Anhand exemplarischer
Reden von Michail Gorbacëv, Boris El’cyn und Vladimir Putin werden wir
Entstehung und Entwicklung von neuen Formen politischer Rhetorik in
Wechselwirkung mit einem neuen politischen System durchleuchten. Nicht die
(wissenschaftlich obsolete) Unterscheidung zwischen guter und schlechter
Rhetorik, Dialogizität und Manipulation steht im Zentrum des Seminars; vielmehr
sollen unterschiedliche Funktionsweisen politischer Rede erläutert werden, die
erst durch eine strukturelle Analyse ersichtlich werden können. Dabei sollen
auch mediale und performative Aspekte politischer Rhetorik berücksichtigt
werden.
Gute Russischkenntnisse werden vorausgesetzt.

Digitales Forum für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Unitags im Wintersemester 2021/22
Hier finden sich außerdem das Programm, wichtige Links und Materialien.

Die empirischen Wissenschaften stehen vor wesentlichen Herausforderungen in Bezug auf die Reproduzierbarkeit und Replizierbarkeit ihrer Ergebnisse. Die sogenannte Replikationskrise beschreibt das Phänomen, dass eine Vielzahl an Studienergebnissen nicht auf unabhängigen Daten bestätigt werden können.
Dies liegt unter anderem an der Tatsache, dass in der Regel eine große Anzahl an verschiedenen Analysestrategien für eine bestimmte Forschungsfrage existiert (>>researcher degrees of freedom<<). Überdies werden die Ergebnisse oftmals nur selektiv für die gewählte Strategie veröffentlicht und die Variabilität in Bezug auf verschiedene andere Ansätze verschleiert (>>selective reporting<<).
Schwerpunkt des Seminars ist die Vermittlung von Grundlagen der Reproduzierbarkeit und Replikation in der Statistik. Die Studierenden werden dazu in die entsprechende Literatur und den Umgang mit geeigneten Tools, wie z.B. Git/Github (Versionskontrolle) und R Markdown (Reporting) eingeführt, um anschließend selbstständig an einer vorgegebenen Fragestellung (unter Einbezug der einschlägigen Literatur) zu arbeiten.
Vorbesprechung: Freitag, 22.10.2021 um 14:00-16:00 Uhr (s.t.) via Zoom
Einführungs-Kurs: Freitag 29.10.2021, 14:00-16:00 Uhr (s.t.) via Zoom
Ort: Das Seminar findet vsl. via Zoom statt.
Anrechnung: 6 ECTS oder 9 ECTS (6 ECTS (Seminar) + 3 ECTS (Wahlpflichtbereich))
Die Vorlesung befasst sich mit multimedialen Dienstangeboten, die über Datennetze realisiert werden. Die Vorlesung befasst sich mit folgenden Themen:

Termine
Termine:
| Termin | Ort | Person | Beginn | |
|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | Mo, 10:15-11:45 Do, 10:15-11:45 (14-tägig) |
[Sowohl virtuell als auch in Präsenz] Geschw.-Sch.-Pl. 1 - B 106 Theresienstr. 39 - B 134 |
Benjamin Sischka |
18.10.2021 |
| Übung |
Mo/Do, 10:15-11:45 (14-tägig) | Virtuell via Zoom |
Malte Nalenz |
28.10.2021 |
Die Lehrveranstaltung, die als Ringvorlesung stattfinden wird, soll die Rolle der Naturwissenschaften und der Digital Humanities in den Historischen Grundwissenschaften beleuchten. Die Vortragenden, durchweg international bekannte Spezialistinnen und Spezialisten in ihren Fachbereichen, werden u. a. zu Palimpsesten und Möglichkeiten ihrer materialtechnologischen Auswertung, zur Rolle der Digital Humanities in der Wasserzeichenforschung, zur Fragmentforschung und zur automatischen Schrifterkennung sprechen. Das genaue Programm findet sich hier:
https://www.hgw.geschichte.uni-muenchen.de/aktuelles/termine/ringvorlesung_2021-22/index.html
Im Rahmen des Historikertags 2021 in München sollen
in Form einer Vitrinenausstellung die bekanntesten Stücke (insbesondere
Handschriften, aber auch Karten) aus der Sammlung der Münchener
Universitätsbibliothek präsentiert werden. Die Lehrveranstaltung dient der
Gestaltung dieser Ausstellung: Ziel ist, zunächst die Bedeutung und die
Wirkungsgeschichte der betreffenden Objekte zu erschließen, ehe in einem
zweiten Schritt überlegt werden soll, wie das jeweilige Exponat in der
Ausstellung am wirkungsvollsten präsentiert und mit welchen Begleittexten es
einer breiteren Öffentlichkeit erschlossen werden kann.
Im Kooperationsprojekt des Instituts für Kunstpädagogik mit dem Haus der Kunst sollen zur Ausstellung Phyllida Barlow kunstpädagogische Vermittlungskonzepte entwickelt und umgesetzt werden. Diese werden in einer Aktionswoche (12.-18.07.) durchgeführt. Die Themen und Inhalte des Haus der Kunst können so spannend neu verhandelt werden – digital und doch sinnlich, ästhetisch und motivierend!
Kurszeiten:
Wöchentlich 22.04. bis 22.07.2021 je Donnerstags 14:15-16:30 Uhr per Zoom:
Kontakt per E-Mail
Anja Gebauer: anja.gebauer@lmu.de (Bitte nur in dringenden Fällen, Fragen bitte im Forum "Fragen" stellen!)
Sandra Falkenstein: sandra.falkenstein@lmu.de
Allgemeine Hinweise zu Videokonferenzen

Im Rahmen dieser Lehrveranstaltung, die sich aus einzelnen Vorträgen der Dozent*innen des Instituts für Kunstpädagogik zusammensetzt, erhalten die Studierenden einen Überblick über zentrale Inhalte der Kunstpädagogik. Die Prüfungsleistung wird in Form einer Klausur erbracht. In der Woche vor der Klausur (05.07.2021) findet eine Probeklausur (28.06.2021) statt.
Mitte des letzten Jahres zeichnete die Stadt München Jörg Widmann (*1973) mit ihrem Musikpreis aus und ehrt damit "einen universalen Musiker, der als Instrumentalist, Komponist und Dirigent eine Ausnahmeerscheinung in der internationalen Klassikszene ist" (Pressemeldung).
Seine vielfältigen Tätigkeitsfelder als weltweit gefragter Klarinettist, Komponist und Dirigent, aber auch als Lehrender und Musikvermittler, lassen ihn als geradezu ideale Persönlichkeit erscheinen, um mit ihm einen Blick in die Musikgeschichte zu werfen und eine "lebendige Aufführungspraxis" der Musik vergangener Jahrhunderte zu diskutieren.
Im Seminar soll Widmanns kompositorische Auseinandersetzung mit Werken anderer Komponist:innen im Fokus stehen, wobei diese selbstredend durch seine aktive Musikerkarriere beeinflusst wird. Seine Klavierzyklen können als Referenzen auf Schubert, Schumann und Brahms verstanden werden, seine Solokonzert scheinen von den Schatten früherer Kompositionen begleitet zu werden und seine jüngsten Streichquartette werden bewusst als "Studien über Beethoven" bezeichnet. Gemeinsam soll herausgearbeitet werden, wie Widmann trotz spielerischer Anklänge und Scheinparallelen gerade eine Différance herausarbeiten möchte, die einen frischen Blick auf die Musikgeschichte evoziert.
Ähnlich zu seinen "Zeitensprüngen", die er anlässlich des 450jährigen Bestehens der Staatskapelle Berlin 2019/20 komponierte, soll gemeinsam der Bogen aus dem 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart geschlagen und die "Rückschau auf die Historie" mit einer "Tuchfühlung zur Gegenwart" verbunden werden. Neben den Werken Widmanns sollen hierbei beispielsweise Kompositionen von J. S. Bach, L. v. Beethoven, J. Brahms, J. Haydn, F. Mendelssohn-Bartholdy, W. A. Mozart, N. Paganini, F. Schubert, R. Schumann sowie Werke aus der Moderne besprochen werden, zugleich aber auch Einflüsse von der Folklore über Jazz bis zur Techno-Musik der 1990er Jahre aufgezeigt werden.
Neben Konzertbesuchen, als Ergänzung zu den Seminarinhalten, ist ein Gespräch mit dem Komponisten ebenso angedacht wie eines mit einer Interpretin seiner Werke.

Wir werden uns zunächst per Lektüre und Diskussion einen kleinen Einblick in grundlegende physikalische Eigenschaften des Schalls erarbeiten. Derart ausgerüstet, wagen wir uns sodann an ausgewählte Themen der Akustik und Psychoakustik heran – Stichworte sind: Klangerzeugung der Musikinstrumente und der menschlichen Stimme, Funktion des menschlichen Hörapparates, Klangwahrnehmung und Empfindungsgrößen, Klangfarbe, Konsonanz und Dissonanz, Tonsysteme und Stimmungssysteme, Klangsynthese und -analyse, Akustik von Räumen, elektronische Musik. Außerdem können wir geeignete Themen, die sich aus den Interessen der Teilnehmerinnen und -nehmer ergeben, aufgreifen. Wegen der erfreulichen Resonanz beim letzten Kurs werden wir auch diesmal wieder – soweit wir in Präsenz arbeiten können – anhand einer kleinen Versuchsanordnung und mit Hilfe von allerlei "musikalischen" Gegenständen aus meinem Haushalt das eine oder andere Angelesene experimentell überprüfen, gutheißen, verwerfen... Der Lektürekurs ist offen für alle. Voraussetzung für die Teilnahme ist lediglich die Bereitschaft, die jeweiligen Texte zuhause aufmerksam durchzulesen und gelegentlich eine kurze Zusammenfassung vorzubereiten. |
