Einführung in die Soziologie (01)
14-16 Uhr ct.
Zoom-Meeting beitreten
https://lmu-munich.zoom.us/j/95117620749?pwd=TE5ETDFsQXlXMTE3QVlpV0krMTluQT09
Meeting-ID: 951 1762 0749
Kenncode: 627151
Termine und Personen:
Einschreibeschlüssel: LiMo_2021
The "Advanced Programming (R)" course targets students in the Statistics and Data Science Master's programme (WP47).
The course can also be taken by advanced Bachelor's students
that have taken "Programmieren statistischer Software". For Bachelor students, Advanced
Programming can be credited as WP4/WP7 (Bachelor PO 2021), or WP2/WP8 (Bachelor PO 2010).
The first lecture will happen on Thursday, 2023-10-19, 18:00--20:00 c.t., location t.b.a.
Enrollment key: advaprogr2324
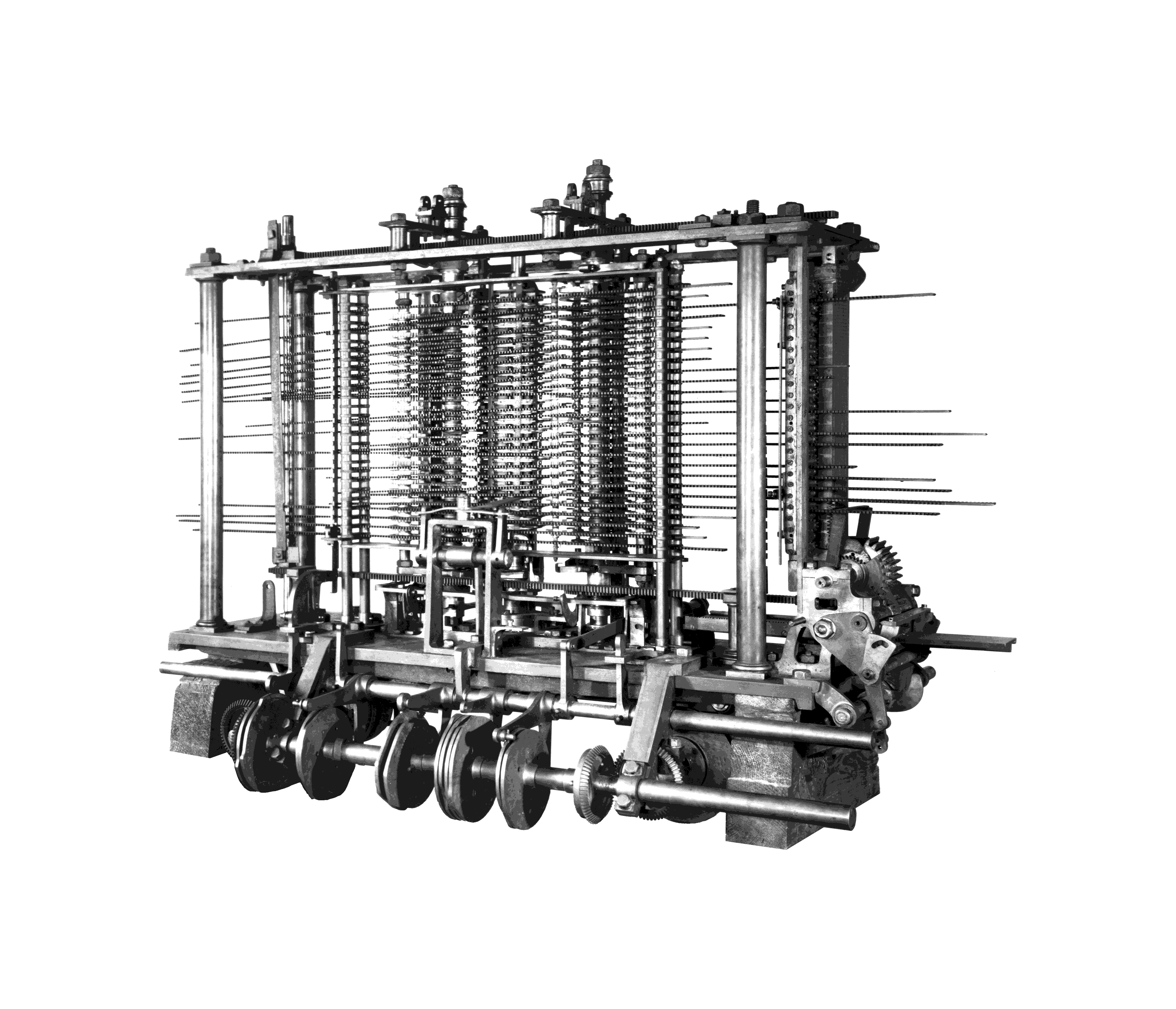

Z I E L G R U P P E + E C T S :
DaF Master PStO 2019: 3 ECT
SKD PStO 2020: 2 ECTS
BSD PStO 2021: 2 ECTS
S C H L Ü S S E L :
OnlineKurs25/26
Einschreibung ab 22.09.25 möglich

Description:
Basic concepts of the analysis of longitudinal data
are covered. Marginal
models as well as mixed effects (also known as random effects) models
for both Gaussian and discrete response variables are discussed.
In the lab, the students are encouraged to apply the lecture contents to
real data in order to deepen the understanding of the discussed
concepts and to become more familiar with the learned methods and
techniques.
Organization and Dates:
Flipped Classroom with Q&As via zoom every
Tuesday 8.30 - 10.00; Thursday 14.15 - 15.45
Enrolment Key: Longi2021!
Target Audience:
Statistics Master students, recommended prerequisites:
Description
The course is a practical introduction into TensorFlow and PyTorch as a software with their practical application in statistics and deep learning. The course covers
in TensorFlow and PyTorch.
Target audience
Statistics and Data Science Master students
Enrollment Key
appliedDL2021!
Key: BigDataSocialScience
Instructors
Frauke Kreuter frauke.kreuter@stat.uni-muenchen.de
Please contact Carolina Haensch (anna-carolina.haensch@stat.uni-muenchen.de) if you have any questions.
Learning outcome
Learn how to think about data analysis to solve social problems using and combining large quantities of heterogeneous data from a variety of different sources. Learn how to evaluate which data are appropriate to a given research question and statistical need. Learn the different data quality frameworks and learn how to apply them. Learn the basic computational skills required for data analytics (for text-mining, large-scale data integration and visualization), typically not taught in social science, economics, statistics or survey courses. Learn how to apply statistical and data quality frameworks to big data problems.
Organization
This is a block course (meetings on 6 days over Zoom), the course language is English.
The course will consist of recorded lectures, prepared materials like course notebooks with exercises and a course project as well as meetings on six days in September 2021 (probably 13.-17.9 and 20.9.).
Can count towards:
WP 16 Advanced Methods in Social Statistics and Social Data Science
WP 39 Computational Social Science
Die Veranstaltungen EMOS A und EMOS B geben aus einer methodischen Perspektive einen Überblick über zentrale Konzepte der amtlichen Statistik. Besprochen werden in EMOS B u.a. folgende Themen: nationale und internationale Armutsmessung, dynamische Indikatoren der Wirtschaftsstatistik, grundlegende Konzepte und Methoden der Bevölkerungsstatistik/Demographie, spezielle Bereichsstatistiken (Haushalts-, Todesursachen- und Unternehmensstatistiken), Linkage und Matching von Datensätzen.
Diese Veranstaltung ist eine Pflichtveranstaltung für alle
Studierenden, die das EMOS-Zusatzzertifikat (European Master in Official
Statistics) erwerben wollen; alle anderen Masterstudierenden können
sich 6 ECTS-Punkte flexibel anerkennen lassen. Ein vorhergegangener Besuch von EMOS A (immer im Winteresemester
angeboten) ist nicht notwendig.
Das Forschungskolloquium ist der Rahmen für die Präsentationen
jener Abschlussarbeiten, die BA- and MA-Studierende im Sommersemester 2021 im
Kontext der Abteilung Alten Geschichte erstellen.
Das Seminar ist ein Kooperationsprojekt des Lehrstuhls für Sozialpsychologie (Prof. Gollwitzer) und der Unternehmensberatung Breitenstein Consulting mit ausgewählten Firmen aus der Wirtschaft und sozialen Organisationen.
Die Teilnehmer/innen des Seminars haben die Chance in einem Change-Prozess aktiv mitzuwirken. Dabei erarbeiten die Seminarteilnehmer/innen in Projektgruppen und unter intensiver Supervision einzelne Maßnahmen z.B. zu den Themen:
Die erarbeiteten Konzepte werden in engem Kontakt mit den Führungskräften und ihren Mitarbeiter*innen umgesetzt. Da es sich zum Teil um Projekte in internationalen Unternehmen handelt, besteht dabei zusätzlich die Chance englische Sprachkenntnisse weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Darüber hinaus wird im Rahmen der wöchentlichen Seminarsitzungen theoretisches und praktisches Hintergrundwissen zu Change Management vermittelt. Dazu gehört die Führung von Veränderungsprozessen, sowie Grundsätzliches zur Beratung von Organisationen. Dabei werden auch Gastreferent*innen aus Universität und Wirtschaft eingeladen und gerne für Diskussionen und Fragen bereit stehen.
Aufgrund der aktuellen Situation finden alle Elemente des Seminars online statt. Dazu gehört auch die Projektarbeit in Kollaboration mit den Unternehmen. Zeitlich umfasst das Seminar:
Erwerb eines Zertifikats (Arbeitszeugnis) nach erfolgreicher Teilnahme am o.g. Gesamtprogramm.
Leistungsnachweis: Erstellung einer schriftlichen Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen (Seminararbeit) und Mitwirken an Präsentationen.
Der freiwillige Leistungsnachweis kann folgendermaßen geltend gemacht werden:
BWL & WiPäd:
Intended audience: Advanced students and PhD students in econometrics, statistics, VWL, BWL, mathematics or computer science.
Prerequisites: Profound knowledge in matrix-algebra and econometrics (econometrics I) or statistics (linear models). Basic knowledge in univariate time series analysis is not demanded but of advantage.
Teaching Style: Online via Zoom and Moodle
Examination: (written) Exam
Record of Achievement: 3 ECTS + 3 ECTS
Die Veranstaltung "Programmieren mit Statistischer Software (R)" wendet sich an Studierende im Bachelor Statistik (4. Semester). Sie baut auf den Veranstaltungen "Einführung in die Statistische Software" (1. Semester) und "Statistische Software" (2. Semester) auf.
Die Veranstaltung findet vom 12.04.2021 ausschließlich online statt und verläuft nach dem Inverted Classroom Prinzip.
Einschreibeschlüssel: progr2021
Wichtige Aspekte des Kurses:
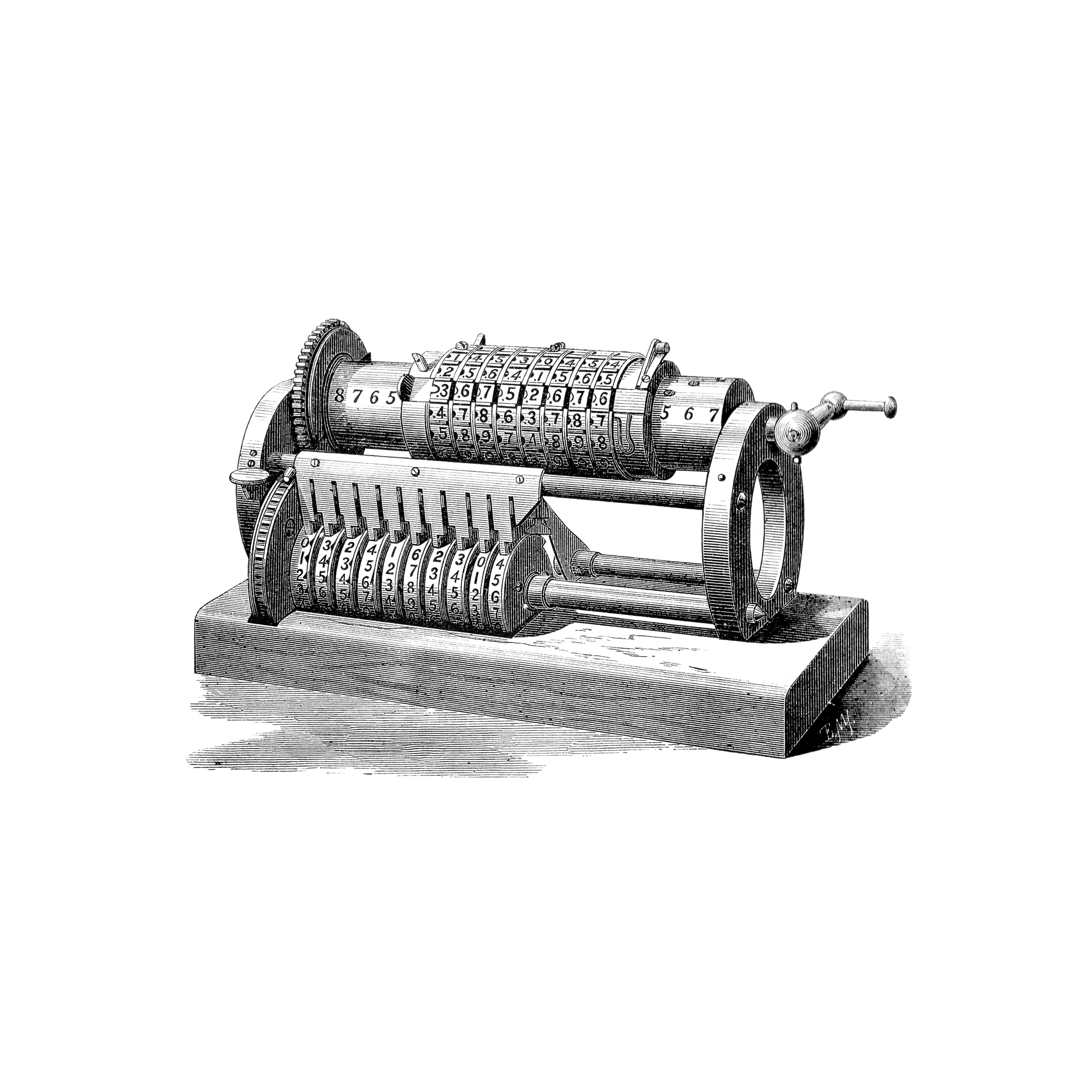
Prüfungskurs für die Modulprüfung Psychologie I (EWS) im Sommersemester 2021

Prüfungskurs für die Modulprüfung Psychologie II (EWS) im Sommersemester 2021

VL: Marcel Neunhoeffer
Übung: Anna-Carolina Haensch
Tutorium: Christoph Heindl
Termine Vorlesung:
| Mo. | 12:00 bis 14:00 c.t. |
Termine Übung (nur eine Übung muss besucht werden!):
Die Übung von Gruppe 1 startet am 20.4, die Übung von Gruppe 2 startet am 21.4
Di. 16:00 bis 18:00 c.t.
Mi. 14:00 bis 16:00 c.t.
Termine Tutorium:
Das Tutorium startet in der dritten Vorlesungswoche (29.04.).
Do. 10:00 bis 12:00 c.t.
Einschreibeschlüssel: Stat2Soz!2021
Die Veranstaltung "Statistische Software (R)" wendet sich an Studierende im Bachelorstudiengang Statistik (2. Semester).
Person: Dr. Cornelia Oberhauser
SAS-Kurs als 5-tägiger Blockkurs in den Semesterferien
Termine:
| Tag |
Uhrzeit |
Raum |
|
|---|---|---|---|
| Mo 20.09.2021 |
Vorlesung | 9:15 - ca. 12:15 |
online über Zoom |
| Übung |
13:15 - 17:00 |
online über Zoom |
|
| Di 21.09.2021 |
Vorlesung |
9:15 - ca. 12:15 | online über Zoom |
| Übung | 13:15 - 17:00 | online über Zoom | |
| Do 23.09.2021 |
Vorlesung | 9:15 - ca. 12:15 | online über Zoom |
| Übung | 13:15 - 17:00 | online über Zoom | |
| Mo 27.09.2021 |
Vorlesung | 9:15 - ca. 12:15 | online über Zoom |
| Übung | 13:15 - 17:00 | online über Zoom | |
| Di 28.09.2021 |
Vorlesung | 9:15 - ca. 12:15 | online über Zoom |
| Übung | 13:15 - 17:00 | online über Zoom |
Gastschlüssel
Intended audience: Advanced bachelor and master students of statistics, mathematics, computer science (Informatik), economics and business administration.
Prerequisites: Solid mathematical foundations (analysis and linear algebra), basic knowledge in econometrics (econometrics 1) or statistics (linear models).
Teaching Style: Online via Zoom and Moodle in english
Examination: (written) Exam
Record of Achievement: 6 ECTS
The lectures and tutorials take place between 12.04.2021 (first lecture) and 18.05.2021.
Intended audience: Advanced bachelor and master students of statistics, mathematics, computer science (Informatik), economics and business administration.
Prerequisites: Solid mathematical foundations (analysis and linear algebra), basic knowledge in econometrics (econometrics 1) or statistics (linear models).
Record of Achievement:
Areal data is a data format in which point observations are aggregated over subregions of a predefined space. These subregions are non-overlapping and make up the entire space. This format is predominately common in medical research and one of the central formats in which, for example, data on Corona infections and hospitalizations were available. Due to the loss of information on the specific point of observation, the estimation of the spatial correlation can become a bit trickier than in spatial point processes. In recent years, especially during the pandemic, working with this type of data has become more relevant for data scientists and statisticians not only due to the relevance of their context but also due to somewhat recent advancements in research on network or graph theory, which allowed research on the statistical methods designed to work with this data more diverse.
Phase II:
Phase III:
Tbd
Phase IV:
Tbd
Intended audience: Advanced bachelor and master students of statistics, mathematics, computer science (Informatik), economics and business administration.
Prerequisites: Solid mathematical foundations (analysis and linear algebra), basic knowledge in econometrics (econometrics 1) or statistics (linear models).
Record of Achievement:
Die Veranstaltung wendet sich an Studierende im Bachelor Statistik (3. / 4. Semester). Das "Grundlegende Praxisprojekt" (BA Statistik und Data Science - PO 2021) ist eine Pflichtveranstaltung (Modul P 11.1).
Die Veranstaltung wird während der Vorlesungszeit angeboten. Diese Die Einführungsveranstaltung mit Anwesenheitspflicht findet am 23.04. 9-11 statt.
Aus organisatorischen Gründen ist eine frühzeitige, separate Anmeldung für die Teilnahme während der Vorlesungszeit nötig -- schreiben Sie sich bitte ein und gehen Sie dann zur Anmeldung auf der Kursseite.
Einschreibeschlüssel: grndlgnprks24
Schedule
| Time | Lecturer | Begin | |
|---|---|---|---|
Lecture | Tuesday, 12:15 - 13:45 | Prof. Dr. Heumann | 16.04.2024 |
Exercise course (Group 1) | Wednesday, 08:15- 09:45 | Sapargali, Garces Arias | 24.04.2024 |
Exercise course (Group 2) | Wednesday, 14:15 - 15:45 | Sapargali, Garces Arias | 24.04.2024 |
Lecture | Friday, 10:15 - 11:45 | Prof. Dr. Heumann | 19.04.2024 |
| Tutorium | Friday, 08:15 - 09:45 | Stephan | 26.04.2024 |
Intended audience: Advanced bachelor and master students of statistics, mathematics, computer science (Informatik), economics and business administration.
Prerequisites: Solid mathematical foundations (analysis and linear algebra), basic knowledge in econometrics (econometrics 1) or statistics (linear models).
Record of Achievement:
Schedule:
| Time | Lecturer | Begin | |
|---|---|---|---|
Lecture |
Tuesday, 12:15 - 13:45 |
Prof. Dr. Heumann |
29.04.2025 |
Exercise course (Group 1) |
Wednesday, 08:15 - 09:45 | Sapargali, Garces Arias |
30.04.2025 |
Exercise course (Group 2) |
Wednesday, 14:15 - 15:45 |
Sapargali, Garces Arias |
30.04.2025 |
| Tutorial | Thursday, 08:15 - 09:45 |
Jai |
24.04.2025 |
Lecture |
Friday, 10:15 - 11:45 |
Prof. Dr. Heumann |
25.04.2025 start of lecture |
In der Vorlesung werden empirische Befunde aus den Themenfeldern Familie,
Arbeitsmarkt und Bildung aufgegriffen und die theoretischen Zugänge der Soziologie
und Ökonomie zu denselben diskutiert. Ziel ist, ein vertieftes Verständnis der
Teilnehmenden für die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der disziplinären
Perspektiven zu entwickeln und diese in Bezug zu aktuellen überwiegend quantitativ -
empirischen Befunden zu setzen. Wesentliche querschnittliche Analyseperspektiven
sind Geschlecht, Region und die Rolle von Institutionen.
Die Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens durch die Corona-Pandemie beeinflussen auch die Qualitative Sozialforschung, die häufig mit kontaktgebundenen Erhebungsmethoden einhergeht. In der Übung wird den Studierenden die Möglichkeit gegeben, eine qualitative Erhebungsmethode „auf Distanz“ zu erproben: das Online-Leitfadeninterview. In Gruppenarbeit entwickeln die Studierenden eine Forschungsfrage zum Thema „Studieren in der Corona-Pandemie“ und erstellen darauf aufbauend einen Leitfaden. Sie planen die Erhebungssituation und führen selbstständig ein Online-Leitfadeninterview durch, das im Anschluss transkribiert wird.
Was wird erwartet in dieser Übung?
Prüfungsleistung: Die Prüfungsleistung wird in Form einer Hausarbeit (ca. 30.000 Zeichen pro Person) erhoben. Näheres erfahren Sie in den Sitzungen.
Der Aufstieg und die zunehmende Normalisierung rechtsradikaler Politik bleiben eine kontinuierliche Herausforderung für die Demokratie sowohl in „West-“ als auch in „Osteuropa“. Ziel dieses Seminars ist, diese Problematik aus einer vergleichenden, europaweiten Perspektive zu untersuchen. Gleichzeitig zielt das Seminar darauf, Studierenden die theoretischen und analytischen Werkzeuge politischer Soziologie zur Analyse rechtsradikaler Politik zu vermitteln. Zunächst wird Rechtsradikalismus im Hinblick auf seine soziopolitischen Entwicklungen konzeptualisiert. Darauffolgend werden einschlägige Erklärungsansätze hinter Normalisierungsprozessen und dem Aufstieg rechtsradikaler Politik besprochen. Schließlich widmen wir uns der Auswirkung rechtsradikaler Politik auf Gesellschaften und Demokratie in Europa.
Die Bereitschaft zur Lektüre englischsprachiger Texte wird vorausgesetzt.
LiteraturBohman A (2011) Articulated antipathies. Political influence on anti-immigrant attitudes. International Journal of Comparative Sociology 52(6): 457–477.
Mudde, C. (2010) ‘The Populist Radical Right: A Pathological Normalcy’, West European Politics 33(6): 1167–86.
Pytlas, B. (2018) ‘Radical right politics in East and West: Distinctive yet equivalent’, Sociology Compass 12(11): 1-15.
Rydgren, J. (2007) ‘The Sociology of the Radical Right’, Annual Review of Sociology 33: 341–62.
In the course of recent decades, radical right politics increasingly shifted from the margins to the mainstream of the political process and continues to constitute a major challenge to liberal democracies in both ‘West’ and ‘East’. This seminar will explore and analyse PRR politics from a Europe-wide perspective. The seminar at the same time aims to provide the students with the conceptual and analytical toolkit of political sociology that can be applied to explore multiple dimensions of political agency in the political process. The seminar will begin by conceptualizing radical right politics in the contexts of its socio-political emergence. We will also discuss different demand- and supply-side mechanisms behind the rise and normalization of radical right politics. Finally, the seminar will explore the patterns, dynamics and consequences of PRR impact on societies and liberal democracies across Europe.
Literature
Bohman A (2011) Articulated antipathies. Political influence on anti-immigrant attitudes. International Journal of Comparative Sociology 52(6): 457–477.
Mudde, C. (2010) ‘The Populist Radical Right: A Pathological Normalcy’, West European Politics 33(6): 1167–86.
Pytlas, B. (2018) ‘Radical right politics in East and West: Distinctive yet equivalent’, Sociology Compass 12(11): 1-15, doi:10.1111/soc4.12632.
Rydgren, J. (2007) ‘The Sociology of the Radical Right’, Annual Review of Sociology 33: 341–62.
Das Seminar zielt darauf, theoretische Ansätze sowie empirische Befunde zu gesellschafspolitischen Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa (MOE) zu erörtern sowie zu diskutieren, welche Lehren diese für ein besseres Verständnis aktueller Phänomene auch jenseits dieser diversen Region bieten. Inwiefern unterschieden sich die dreifachen wirtschaftlichen, soziokulturellen und politischen Modernisierungsprozesse nach 1989 von Entwicklungen in anderen Regionen – und inwiefern gab es auch Ähnlichkeiten? Spielen diese Prozesse überhaupt noch eine Rolle? Wie kann die Analyse unterschiedlicher – nicht nur populistischer – Anti-Establishment-Parteien in der Region zum besseren Verständnis aktueller politischer Turbulenzen in Europa beitragen? Welche Lehren können wir aus dem Aufstieg von Rechtsradikalismus sowie aus Entdemokratisierungsprozessen in MOE ziehen? Und welche aus der andauernden Aktivität pluralistisch-demokratischer zivilgesellschaftlicher Akteur*innen und Bewegungen?
Vertiefte Kenntnisse zu Mittel- und Osteuropa sind keine Voraussetzung für die Teilnahme. Die Teilnehmenden sollten gleichzeitig bereit sein, sich zu den wichtigsten Entwicklungen in der Region, die für Sie von Interesse sind, zu informieren. Die Bereitschaft zur Lektüre englischsprachiger Texte wird vorausgesetzt.
In dieser Übung zur Anwendung qualitativer Methoden werden wir die Forschungsperspektive der Wissenssoziologischen Diskursanalyse (WDA) im thematischen Kontext der Covid-19-Pandemie kennenlernen. Dazu lesen wir einschlägige methodologische und thematische Literatur und lernen die Grundbegriffe der WDA kennen. Parallel dazu entwickeln wir gemeinsam geeignete (wissens-)soziologische Fragestellungen im Kontext der Covid-19-Pandemie. Davon ausgehend werden die Teilnehmenden eigene (kleine) Projektarbeiten entwickeln und Daten sammeln. Wir lernen Strategien zur Datensammlung und -auswertung kennen und arbeiten dann in gemeinsamen Materialwerkstätten an den Projekten.
|
In Deutschland und ganz Europa sind rechte Parteien auf dem Vormarsch. Gleichzeitig gibt es bedeutende Migrationsströme. Angst vor Immigration der „einheimischen“ Bevölkerung stellt dabei eine große Hürde bei der Integration von Migranten dar. Vor diesem Hintergrund bietet der Kurs eine unideologische Herangehensweise an eine teilweise hitzig geführte Debatte. Empirische Studien sollen helfen zu erklären, welche Bevölkerungsgruppen negative Einstellungen gegenüber Immigration zeigen. Dabei beleuchtet der Kurs insbesondere Zusammenhänge zwischen sozialer Ungleichheit und einer ablehnenden Haltung gegenüber Migration. Weiterhin werden räumliche und zeitliche Muster analysiert. Für die Teilnahme am Kurs wird die Bereitschaft sich in englischsprachige, statistisch anspruchsvolle, quantitativ empirische Texte zu vertiefen, vorausgesetzt. |
Kann man sich sinnvoll mit einer Sprache beschäftigen, die man nicht einmal aussprechen kann? – Ja! Das Sprachphylum Khoisan hat viel mehr zu bieten als die spektakulären Klicks („Schnalzlaute“) und komplexe Tonregeln.
Khoekhoe (auch Nama, Khoekhoegowab, seltener Damara, genannt) repräsentiert mit über 200.000 Sprechern die größte aller modernen Khoisan-Sprachen. Das Verb weist wenig Markierung, aber wie viele afrikanische Sprachen vielseitige derivative Erweiterungen auf. Die Nominalphrase ist komplex aufgebaut, es gibt drei Genera (maskulin, feminin und communis) und drei Numeri (Singular, Dual und Plural). Als Fokus-orientierte Sprache hat Khoekhoe eine hauptsächlich pragmatisch konditionierte Wortstellung. Außerdem verfügt die Sprache über komplex verschachtelte Nebensätze, "eine Erscheinung, die sich nicht als eine [...] erzwungene Anähnlichung an unsere Sprache, sondern als wirklich begründet in dem so eigenartigen Idiom [...] zu erweisen scheint" (Lewy 1965). Die Afrikanistin Kilian-Hatz hat die Komplexität von Khoekhoegowab in einem Interview mit dem Geo-Magazin 2003 unter dem provokanten Titel "Gibt es primitive Sprachen?" nicht ganz zu Unrecht mit Latein verglichen. Aber keine Angst - wir werden mit ganz einfachen Sätzen anfangen und die spannenden Eigenschaften Schritt für Schritt kennenlernen.
Im zweiten Teil des Strukturkurses werden weitere Themen behandelt. Vorgesehen sind u.a.
In Fortführung des ersten Kurses werden in „Cultural notes“ weitere Khoisan-Ethnien kurz vorgestellt.
Wegen COVID-19 wird der Kurs 'remote' stattfinden: Sie erhalten regelmäßig ausführliche Handouts. Als Prüfungsleistung sind 4 Übungsblätter vorgesehen. Die Teilnahme über Moodle wird empfohlen.
herzlich Willkommen im Proseminar Digitale Lexikographie.
Für das Seminar lege ich Ihnen folgende Lektüre ans Herz:
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches, lehrreiches Sommersemester 2021.
https://lmu-munich.zoom.us/j/93016445944?pwd=ZlFuRno3bXBUVDZ1R0hEQzRjOVVQQT09
Meeting-ID: 930 1644 5944
Kenncode: 872177

In dieser Übung beschäftigen wir uns mit verschiedenen soziologischen Perspektiven auf Mutterschaft. Zum einen werden historische Perspektiven eingenommen: Wie hat sich das Konzept Mutterschaft in der Geschichte verändert? Welche Rolle spielt dabei der »Muttermythos« und das normative Muster der »Mutterliebe«? Welche Bilder von Mutterschaft finden wir in der Geschichte? Zum anderen werden wir das Konzept Mutterschaft vor dem Hintergrund verschiedener theoretischer Ansätze beleuchten. Dabei interessieren uns Fragen wie: Wie wirken Naturalisierungen und Ontologisierungen von Differenzkategorien hinsichtlich Mutterschaft, besonders vor dem Hintergrund der Kategorie »Geschlecht«? In welchem Zusammenhang stehen Subjektivierungsprozesse und das Konzept Mutterschaft? Und schließlich werden wir uns empirischen Arbeiten widmen, die - vor dem Hintergrund der besprochenen historischen und theoretischen Perspektiven – aktuelle soziologische Fragestellungen zum Thema Mutterschaft bearbeiten.
Møte-ID: 939 6115 2108
Passord: NorskFI
Gesundheit ist ein zentraler Wert moderner Gesellschaften. Woher aber wissen wir, was gesund ist und krank macht? Und was hat das mit sozialer Ordnung zu tun? In der Lehrveranstaltung erarbeiten wir einen Überblick über die facettenreichen soziologischen Perspektiven auf das Themenfeld Gesundheit und Krankheit. Den Ausgangspunkt liefert eine kritische Reflektion rein biomedizinischer Erklärungsmodelle. Dabei interessiert einerseits deren Erweiterung um gesellschaftliche Faktoren, wie etwa Einflüsse von sozialer Ungleichheit. Andererseits wird sichtbar, dass Definitionen von Gesundheit und Krankheit historisch wandelbar, umstritten und eingebettet in spezifische Wissensstrukturen und Machtverhältnisse sind. Vor diesem Hintergrund widmen wir uns außerdem der Organisation des deutschen Gesundheitssystems. Die Covid-19-Pandemie wird uns zu vielen Aspekten passendes Anschauungsmaterial liefern; die Lehrveranstaltung beschränkt sich aber ausdrücklich nicht auf diese Thematik.
Die Übung
setzt sich zunächst mit Klassikern des Wirtschaftsdenkens und zentralen
Grundbegriffen der Wirtschaftssoziologie auseinander.
Anschließend werden
sozialgeschichtliche Entwicklungslinien nachgezeichnet und die soziale
Strukturierung des Wirtschaftslebens untersucht.
Der letzte Teil beschäftigt
sich mit formalen Modellierungen wirtschaftlicher Zusammenhänge, wobei
insbesondere theoretische Grundlagen und empirische Befunde der
Rational-Choice-Soziologie in Augenschein genommen werden.
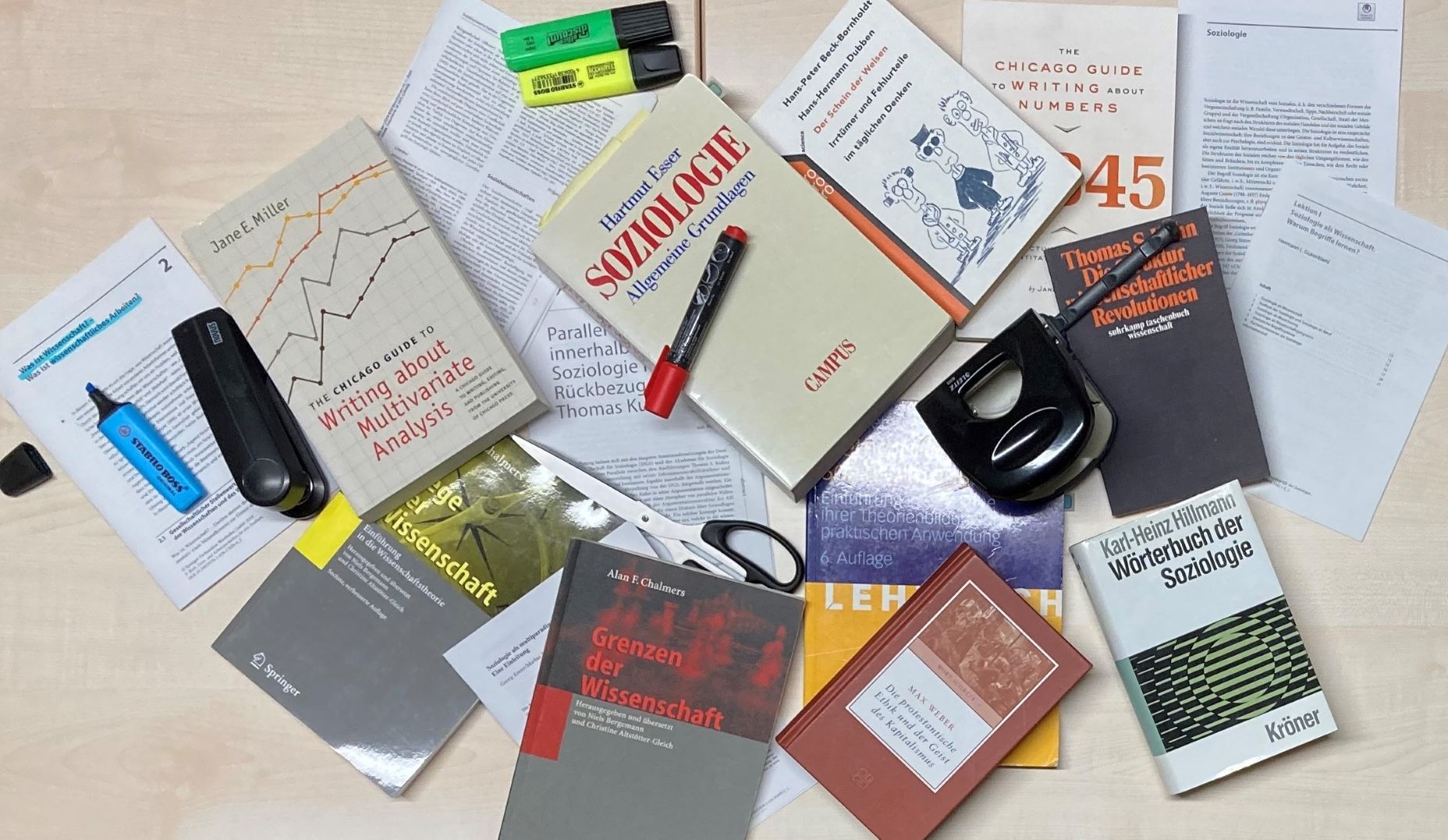
Digitales Forum für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Unitags im Sommersemester 2021
Hier finden sich außerdem das Programm, wichtige Links und Materialien.

„Fiction writers love it. Filmmakers can’t resist it.“ (Parul Sehgal)
Im Dezember 2021 vorveröffentlichte The New Yorker online unter dem Titel „The Case Against The Trauma-Plot“ einen Beitrag der Journalistin Parul Sehgal. Er enthielt eine kritische Abrechnung mit einem vorherrschenden Plottypus von Filmen, Serien und Literaturen der Gegenwart. Karl Ove Knausgards Min Kamp-Reihe (2009-2011), Hanya Yanagihara’s A Little Life (2015), Ted Lasso (2020, Apple TV+), Reservation Dogs (2021, FX) und WandaVision (Disney+, 2021), – um nur einige zu nennen. Nicht allein die Aufzählungen all jener Beispiele, die sich durch einen trauma-plot auszeichnen, verblüfft, sondern auch der Seghals Befund, dass nämlich der Trauma-Plot moralisch belehre und Charaktere auf ein Symptom hin „verflache, verzerre, reduziere“. Allen voran führe er dazu, dass wir die Freude des Nichtwissens und der Intransparenz vergessen. Zwar sind die traumatisierten Akteure von Erinnerungslücken, Gedächtnisverlust, dekontextualisierten Flashbacks und Intrusionen, von obsessiven Wiederholungshandlungen oder depressiven Episoden geplagt, doch die Rekonstruktion der Ereignisse, die Suche nach dem traumatischen Kern gibt die Struktur der Handlung vor: am Ende steht die Offenlegung dessen, was wirklich geschah. Der Trauma-Plot „does not direct our curiosity toward the future (Will they or won’t they?) but back into the past (What happened to her?)”, so Seghal. Damit scheint ein zentraler Bezugspunkt zu unserer Gegenwart gegeben, die ganz allgemein ein Mangel an Zukunftsentwürfen auszeichnet. Im Seminar wollen wir uns dem Trauma-Plot mit einem kulturwissenschaftlichen Interesse aus medien-, film- und literaturwissenschaftlicher Perspektive widmen. Wir wollen uns mit Vorläufern des Trauma-Plots und strukturverwandten Genres beschäftigen sowie mit Theorien der Erzähl- bzw. Darstellbarkeit des Ereignisses. Begleitend wird ein Lektürekurs stattfinden. |
4-day block course in the semester break
Meetings:
Day | Time | Room | |
Mo 16.08.2021 | Lecture | 9:00 - 12:00 | online via Zoom |
Lecture | 14:00 - 17:00 | online via Zoom | |
Tu 17.08.2021 | Lecture | 9:00 - 12:00 | online via Zoom |
Lecture | 14:00 - 17:00 | online via Zoom | |
We 18.08.2021 | Lecture | 9:00 - 12:00 | online via Zoom |
Lecture | 14:00 - 17:00 | online via Zoom | |
Th 19.08.2021 | Lecture | 9:00 - 12:00 | online via Zoom |
Lecture | 14:00 - 17:00 | online via Zoom |
Course summary: The social survey is a research tool of fundamental importance across a range of disciplines and is widely used in applied research and as evidence to inform policy making. This course considers the process of conducting a survey, with an emphasis on practical aspects of survey design and implementation, as well as estimation. The course will introduce students to the basic principles of survey design that are used in large-scale surveys. The course will also provide an introduction to key elements of conducting a survey, including procedures in sample design, alternative modes of data collection, questionnaire design, sources of error, and key statistical concepts in estimation.
This is a block course (four days), the course language is English.
Registration key / Einschreibeschlüssel: SDE2021LMU
Termine und Personen:
| Termin | Ort | Person | |
|---|---|---|---|
| Vorlesung |
Mo, 12.00 - 14.00 |
Zoom |
Dr. Fabian Scheipl |
| Vorlesung |
Mi, 12.00 - 14.00 | Zoom |
Dr. Fabian Scheipl |
| Übung 1 |
Do, 10.15 - 11.45 (ca 14-tägig) |
Schellingstr 3 S 001/Zoom |
Sevag Kevork |
| Übung 2 |
Do, 12.15 - 13.45 (14-tägig) |
Schellingstr 3 S 004/Zoom |
Sevag Kevork |
| Tutorium |
Mi, 8.15 - 9.45 (14-tägig) |
Zoom | Asmik Nalmpatian |
Einschreibeschlüssel:
Einschreibeschlüssel Selbsteinschreibung / Gast: APR2021
Termine
| Kurs | Zeit |
Ort |
|---|---|---|
| Grundkurs |
Di, 10.11., 16.00 - 19.30 |
online |
| Grundkurs |
Di, 17.11., 16.00 - 19.30 | online |
| Grundkurs |
Di, 24.11., 16.00 - 19.30 | online |
| Aufbaukurs |
Di, 01.12., 16.00 - 19.30 |
online |
| Aufbaukurs |
Di, 08.12., 16.00 - 19.30 | online |
| Kurs | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| Grundkurs | Mo, 22.03., 13.30 - 17.00 | online |
| Grundkurs | Di, 23.03., 13.30 - 17.00 | online |
| Grundkurs | Mi, 24.03., 13.30 - 17.00 | online |
| Aufbaukurs | Do, 25.03., 13.30 - 17.00 | online |
| Aufbaukurs | Fr, 26.03., 13.30 - 17.00 | online |
Moodle-Kurs zur Veranstaltung Statistische Datenauswertung und Visualisierung bei H. Küchenhoff, F. Fleischmann und A. Fenske.
Eine Selbsteinschreibung ist mit dem Schlüssel DHStat2021 möglich.
Lecture (Robert Czudaj)
Tuesday, 4 p.m. - 6 p.m., (Start: November 3, 2020)
Tutorial (Christoph Berninger)
Thursday, 6 p.m. - 8 p.m., (Start: November 12, 2020)
Einschreibeschlüssel:Termine:
Donnerstag & Freitag 14:00-16:00 via Zoom.
Zusätzlich 6-8 h pro Woche für Videos, Lektüre & Programmieraufgaben im Selbststudium.
Einschreibeschlüssel: fort-w2021
Termine und Personen:
| Termin | Ort | Person | |
|---|---|---|---|
| Vorlesung |
Do, 14.15 - 15.45 |
online |
Prof. Dr. Helmut Küchenhoff |
| Übung |
Mo, 14.15 - 15.45 |
online |
Maximilian Weigert |
| Übung |
Mo, 16.15 - 17.45 |
online |
Martje Rave |
| Tutorium |
Do, 08.30 - 10.00 |
online |
Sarah Musiol |
| Tutorium |
Do, 12.15 - 13.45 |
online |
Sarah Musiol |
| Übung |
Montag 14:00 c.t. - 16:00 Uhr | |
| Vorlesung | Dienstag 14:00 c.t. - 16:00 Uhr | |
| Vorlesung |
Mittwoch 12:00 c.t. - 14:00 Uhr | |
| Tutorium | Freitag 12:00 c.t. - 14:00 Uhr |
| Einschreibeschlüssel (sowohl für Selbsteinschreibung, als auch für Gastzugang): Caratheodory |
Der Kurs richtet sich an Quereinsteiger in einer der Masterstudiengänge im Fach Statistik, die im WiSe 2020/21 ihr Studium beginnen.
Einschreibeschlüssel: SuT2021
Veranstaltungstermine:
| Tag | Zeit | Ort |
|
|---|---|---|---|
| Vorlesung | Montag | 12:00 - 14:00 Uhr c.t. | Virtuell via Zoom |
| Übung | Dienstag | 12:00 - 14:00 Uhr c.t. | Virtuell via Zoom |
| Tutorium | Freitag | 08:30 - 10:00 Uhr s.t. |
Virtuell via Zoom |
One of the most challenging aspects of dealing with the ongoing "big
data" explosion is the development of methods that can identify suitable
low-dimensional representations of very high dimensional data sets. The
unifying assumption of all such approaches is that high-dimensional
data are concentrated in a lower-dimensional subspace (a "manifold",
more generally) embedded in the original data space.
In this
seminar, we will introduce the mathematical basics of manifolds and
embeddings and will discuss both foundational papers on popular
dimensionality reduction methods and papers on current research problems
in this setting.
Einschreibeschlüssel: ---
Einschreibeschlüssel Gast: PRAKT2021
Termine:
| Termin | Ort | Person | Beginn | |
|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | Mo, 10:15-11:45 Do, 10:15-11:45 (14-tägig) |
Virtuell via Zoom |
Benjamin Sischka |
02.11.2020 |
| Übung |
Mo/Do, 10:15-11:45 (14-tägig) | Virtuell via Zoom |
Dominik Kreiß | 12.11.2020 |
Einschreibeschlüssel: Wiso2021
Tutorium
Zur Veranstaltung wird ein Tutorium angeboten. Dieses findet Dienstag 18–20 Uhr statt.
Einschreibung
Einschreibeschlüssel: Kolmogorov
Der Lektürekurs wird sich dem Frühen Rom widmen. Der Lektürekanon wird in einem gesonderten moodle-Kurs bereitgestellt. Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird die Anfertigung eines Exzerpts zu einem der zugrunde gelegten Titel (Aufsatz bzw. Abschnitt aus einer Monographie) erwartet. Im Rahmen einer Zwischenbesprechung sollen diese Exzerpte vorgestellt werden. Das Abschlussgespräch gilt der gemeinsamen Diskussion über die Leitfrage der Veranstaltung.
Termine für Vorbesprechung, Zwischenbesprechung und Abschlussgespräch:
Prüfungsform: Gemeinsames Abschlussgespräch
Inverted classroom style. Weekly meeting (in person): Wednesday, 14:00-16:00 c.t. Geschw.-Scholl-Pl. 1 (A) - A 119
Starting date: 20.10.2021
Enrollment Key: automl22
Blockseminar: April 4-6, April 8 and April 11-14, 2022
Einschreibeschlüssel: CSDS2021
Lecture (Robert Czudaj)
Tuesday, 4 p.m. - 6 p.m., (Start: October 19, 2021)
Tutorial (Christoph Berninger)
Thursday, 6 p.m. - 8 p.m., (Start: October 28, 2021)
Einschreibeschlüssel:Willkommen im Moodle für den Kurs "Neuropsychologie neurologischer udn psyciatrischer Erkrankungen". Wir starten am 22.10.2021 um 10 Uhr in Raum 1302.
Allgemeiner Hinweis: für den Zugang zu LMU Gebäuden gilt die 3G Regelung, d.h. ich muss euren 3G-Nachweis vor Beginn der Sitzung kontrollieren und in den Räumen herrscht Maskenpflicht (medizinisch oder FFP2) solange wir den Mindestabstand nicht einhalten können (was in unserem Fall leider nicht geht). Die LMU selbst bietet auch ein Testzentrum an (mehr dazu hier: https://www.lmu.de/de/die-lmu/informationen-zum-corona-virus/hinweise-zu-studium-und-lehre/index.html#st_img_text__master_1).
Präsenzunterricht steht und fällt mit der Ampel, solange aber irgendwie möglich treffen wir uns persönlich!
LSF-Kursbeschreibung: Pathologische (strukturelle und funktionelle) Veränderungen des zentralen Nervensystems (ZNS) sind häufig mit psychischen Funktionsstörungen assoziiert. Profil, Schweregrad und Verlauf der neuropsychologischen Störungen hängen dabei wesentlich von der Ursache dieser Veränderungen ab. Im Rahmen des UK werden neurologische und psychiatrische Erkrankungen sowie die jeweils zugehörigen psychischen Störungsmuster einschließlich ihrer Dynamik im Verlauf besprochen. Neben einer Vertiefung ihres Wissens lernen die Studierenden zudem, ihre Kenntnisse unter Berücksichtigung Ätiologie-spezifischer Faktoren auf Fragen der neuropsychologischen Diagnostik und Intervention anzuwenden.
Prüfungskurs für die Modulprüfung Psychologie I (EWS) im Wintersemester 2021/22

Prüfungskurs für die Modulprüfung Psychologie II (EWS) im Sommersemester 2021

Schedule:
| Date | Place | Lecturer | Begin | |
|---|---|---|---|---|
| Lecture | Tuesday, 16:00 - 18:00 | … | Prof. Dr. Annika Hoyer | 19.10.2021 |
| Exercise & Tutorial | Thursday, 16:00 - 18:00 | … | Dina Voeltz | 26.10.2021 |
Vorlesung Anna-Carolina Haensch (anna-carolina.haensch@stat.uni-muenchen.de)
Übung Jacob Beck, Felix Henninger
Tutor*innen Ilija Spasojevic, Alexandra Holzmann
Einschreibeschlüssel: Stat1Soz2021Einschreibeschlüssel: WiSo202122
Die Veranstaltung wendet sich an Studierende mit Hauptfach Statistik und Data Science bzw. Statistik. Das Fortgeschrittende Praxisprojekt (PO 2021) bzw. Statistische Praktikum (PO 2010) ist für Studierende im Bachelor Studiengang Statistik ein Pflichtbestandteil des Studiums. In Gruppen von 3-4 Personen werden Projekte aus der angewandten Statistik bearbeitet. In der Regel besteht ein Projekt aus statistischen Fragestellungen, die sich aus der Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern ergeben.
Die Veranstaltung wird sowohl während der Vorlesungszeit als auch
in den Semesterferien angeboten. Diese Moodle-Seite ist für beide Veranstaltungen.
Selbsteinschreibungsschlüssel: StatPrak2022
Die Veranstaltung wendet sich an Studierende im Bachelor Statistik (3. Semester). Das "Grundlegende Praxisprojekt" (BA Statistik und Data Science - PO 2021) bzw. "Anfängerpraktikum" (BA - Statistik PO 2010) ist eine Pflichtveranstaltung. Der Bachelor-Studiengang Statistik (PO 2010) kennt weiterhin noch die Veranstaltung "Praxisprojekt", welches eine Wahlpflichtveranstaltung (Wahlplichtmodul 6) ist.
Die Veranstaltung wird sowohl während der Vorlesungszeit als auch in den Semesterferien angeboten. Diese Moodle-Seite ist für beide Veranstaltungen.
Selbsteinschreibungsschlüssel: APR2022
The "Advanced Programming (R)" course targets students in the Statistics and Data Science Master's programme. The course can also be taken by advanced Bachelor's students that have taken "Programmieren statistischer Software". Advanced Programming can be credited as WP4/WP7 (PO 2021), or WP2/WP8 (PO 2010).
The first lecture will happen on Thursday, 2022-10-20, 18:00--20:00 c.t., in Ludwigstr. 28 (Y) RG, Room 023.
The second lecture will be on Thursday 2022-10-27, 18:00--20:00 c.t. at the same place.
Times and dates for the lectures that follow will be discussed on 2022-10-20, so please attend the first lecture (or notify the lecturer if you can't come) if you care about coming to the following ones.
Enrollment key: advaprogr2223
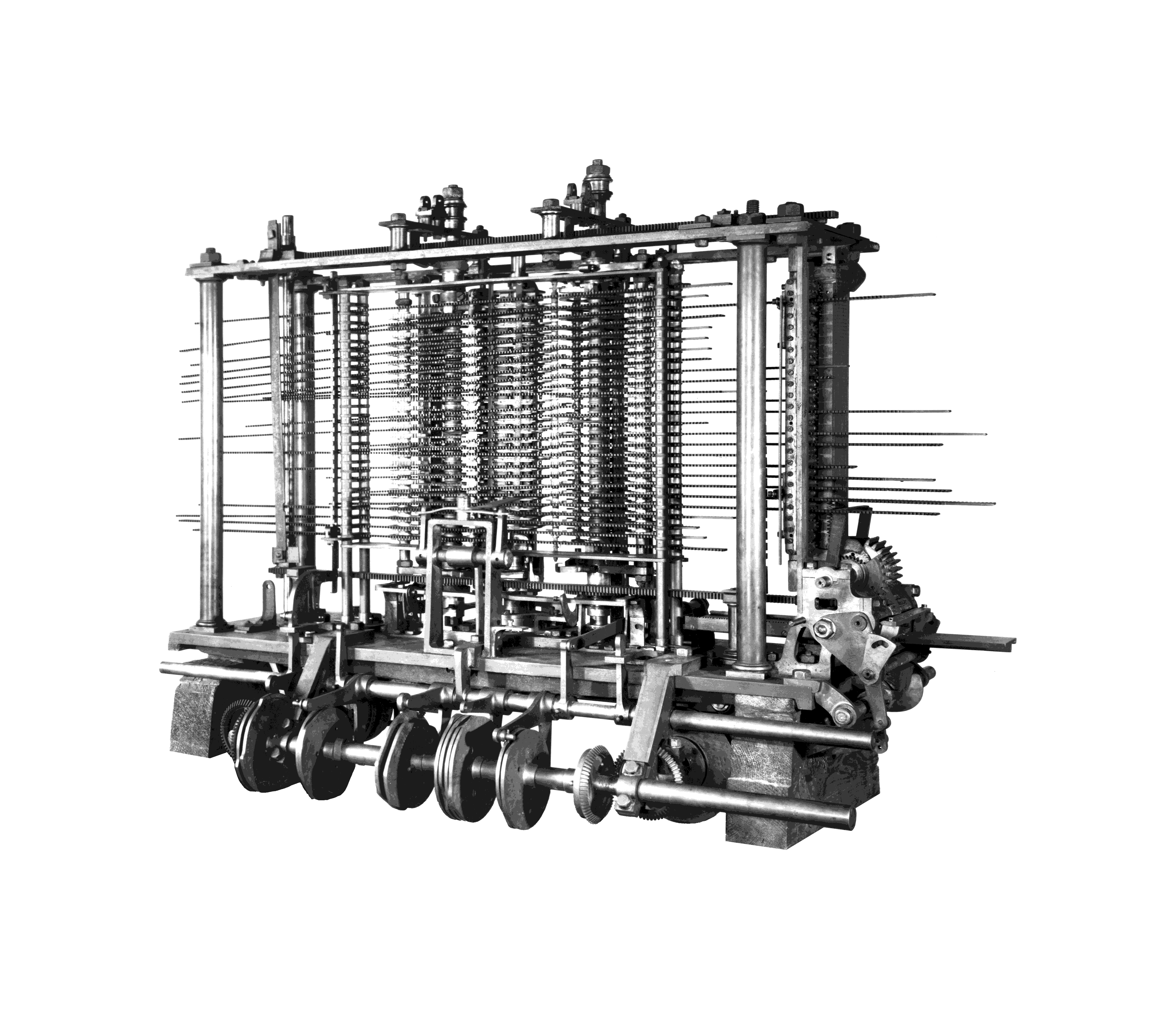
Syllabus
ONLINE COURSE
Teachers: Hanna Brenzel, Hariolf Merkle, Marco Puts, Piet Daas
Runtime: 14. November 2022 - 16. December 2022
Format: Flipped Classroom: Self-learning through online videos and literature, weekly 1-hour online meetings
Examination: Examination sheets (3 ECTS credits)
Language: English
Prerequisites: Basic R knowledge is required.
Who is this course for? MsC Statistics and Data Science (2021, WP 28+29+40+46), BsC Statistics and Data Science (2021, WP 8+11),Bsc Statistik (2010, WP 6.0.3+6.0.4), Statistik und Data Science als Nebenfach für Bachelor 30 ECTS (2021, WP 4+5), Statistik und Data Science als Nebenfach für Bachelor 60 ECTS (2021, WP 11+12), Statistik und Data Science als Nebenfach 30 ECTS Mathematik (2021, WP 5+6), Statistik Nebenfach 60 ECTS Bachelor Soziologie (2021, WP 10+11), Grundlegende Statistik als Nebenfach für MA 30 ECTS (2011, WP 6), Vertiefte Statistik Master (2011, WP 5)
Einschreibeschlüssel: dskrpt
Termine:
| Termin | Ort | Person | |
|---|---|---|---|
| Vorlesung |
Do, 14.00 - 16.00 |
M118 (Hauptgebäude) |
Fabian Scheipl |
| Vorlesung |
Fr, 10.00 - 12.00 | M118 (Hauptgebäude) |
Fabian Scheipl |
| Übung 1 |
Mo, 10.00 - 12.00 |
S004 (Schellingstr. 3) |
Eugen Gorich |
| Übung 2 |
Do, 12.00 - 14.00 | B106 (Hauptgebäude) |
Michael Kobl |
| Tutorium |
Di, 16.00 - 18.00 |
S001 (Schellingstr. 3) | Michael Kobl |
Selbsteinschreibungsschlüssel: grlgprkt
Die
Veranstaltung wendet sich an Studierende im Bachelor Statistik (3.
Semester). Das "Grundlegende Praxisprojekt" (BA Statistik und Data
Science - PO 2021) ist
eine Pflichtveranstaltung (Modul P 11.1).
Die Veranstaltung wird sowohl während der Vorlesungszeit als auch
in den Semesterferien angeboten. Diese Moodle-Seite ist für beide Veranstaltungen.
Für beide Blöcke findet eine Einführungsveranstaltung mit Anwesenheitspflicht am 19.10. 10-12 statt.
Aus organisatorischen Gründen ist eine frühzeitige, separate Anmeldung für die Teilnahme während der Vorlesungszeit nötig -- schreiben Sie sich bitte ein und gehen Sie dann zur Anmeldung auf der Kursseite.
Einschreibeschlüssel: dskrpt
| Termin | Ort | Person | |
|---|---|---|---|
| Vorlesung |
Do, 14.00 - 16.00 |
A140 (Hauptgebäude) |
Fabian Scheipl |
| Vorlesung |
Fr, 10.00 - 12.00 | M118 (Hauptgebäude) |
Fabian Scheipl |
| Übung 1 |
Do, 12.00 - 14.00 |
B106 (Hauptgebäude) |
Yichen Han |
| Übung 2 |
Di, 16.00 - 18.00 |
C123 (Theresienstr. 41) |
Michael Kobl |
| Tutorium |
Di, 18.00 - 20.00 |
S001 (Schellingstr. 3) |
Michael Kobl |
Teacher: Walter J. Radermacher
Runtime: 1. October 2023 - 12. October 2023
Format: Self-learning through online videos in the first week and in-person workshops for practical appliance of use cases in the second week.
Examination: Oral Exam (3 ECTS credits)
Language: English
Who is this course for? MsC Statistics and Data Science (2021, WP 28+29+40+46), BsC Statistics and Data Science (2021, WP 8+11), Statistik und Data Science als Nebenfach für Bachelor 30 ECTS (2021, WP 4+5), Statistik und Data Science als Nebenfach für Bachelor 60 ECTS (2021, WP 11+12), Statistik und Data Science als Nebenfach 30 ECTS Mathematik (2021, WP 5+6), Statistik Nebenfach 60 ECTS Bachelor Soziologie (2021, WP 10+11), WISO Mater (2010, "Ausgewählte Gebiete..." (3ECTS))
Selbsteinschreibungsschlüssel: grlgprkt
Die
Veranstaltung wendet sich an Studierende im Bachelor Statistik & DataScience (3.
Semester). Das "Grundlegende Praxisprojekt" (BA Statistik und Data
Science - PO 2021) ist
eine Pflichtveranstaltung (Modul P 11.1).
Die Veranstaltung wird sowohl während der Vorlesungszeit (in zwei getrennten Termingruppen) als auch
in den Semesterferien angeboten. Diese Moodle-Seite ist gemeinsam für alle Veranstaltungen.
Für alle drei Blöcke finden Einführungsveranstaltungen mit Anwesenheitspflicht am 14. und 21.10.2024, 16-18 Uhr statt. Aus organisatorischen Gründen ist eine frühzeitige, separate Anmeldung für die Teilnahme während der Vorlesungszeit nötig -- schreiben Sie sich bitte in den Kurs ein und melden Sie sich dann auf der Kursseite für einen der 128 während dem Semester verfügbaren Praktikumsplätze an.
Die Veranstaltung wendet sich an Studierende mit Hauptfach Statistik und Data Science bzw. Statistik. Das Fortgeschrittene Praxisprojekt (PO 2021) bzw. Statistische Praktikum (PO 2010) ist für Studierende im Bachelor-Studiengang Statistik ein Pflichtbestandteil des Studiums. In Gruppen von 4-5 Personen werden Projekte aus der angewandten Statistik bearbeitet. In der Regel besteht ein Projekt aus statistischen Fragestellungen, die sich aus der Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern ergeben.
Jede Gruppe hält einen Zwischenvortrag bei dem bisherige Ergebnisse diskutiert und Anreize für weitere Analyse-Ansätze gegeben werden. Abgeschlossen wird das Praktikum mit einem längeren Vortrag in Anwesenheit des Projektpartners.
Die Statistik-Kenntnisse aus der Veranstaltung "Einführung in die lineare statistische Modellierung" bzw. "Lineare Modelle" werden für das Praktikum dringend empfohlen. Ohne diese Kenntnisse wird eine Bearbeitung der Projekte nicht möglich sein.
Die Veranstaltung wird sowohl während der Vorlesungszeit als auch in den Semesterferien angeboten. Die fristgerechte Anmeldung bis zum 30.09.2024 ist notwendig und verpflichtend, um eine ausreichende Menge an Projekten vorbereiten zu können. Ohne Anmeldung kann eine Teilnahme nicht garantiert werden. Bei der Anmeldung bitte auf die Angabe der korrekten Prüfungsordnung achten. Bitte beachten Sie, dass das Einschreiben in diesen Kurs keine Anmeldung darstellt.
Einschreibeschlüssel : statp2425
Schedule:
| Time | Lecturer | Begin | |
|---|---|---|---|
Lecture |
Monday, 10:15 - 11:45 |
Prof. Dr. Heumann |
14.10.2024 |
| Tutorial | Tuesday, 08:15 - 09:45 | Stephan |
22.10.2024 |
Lecture |
Tuesday, 14:15 - 15:45 |
Prof. Dr. Heumann |
15.10.2024 |
Exercise course (Group 1) |
Wednesday, 14:15- 15:45 | Sapargali, Garces Arias |
23.10.2024 |
Exercise course (Group 2) |
Thursday, 08:15 - 09:45 |
Sapargali, Garces Arias |
24.10.2024 |
This bachelor seminar revisits these competing paths and critically compares them to one another. We will read introductory texts to get (more) familiar with frequentist, Bayesian and fiducial inference. We will learn about their differences with respect to both mathematical intricacies and philosophical underpinnings.
The seminar is intended as an introductory course, focusing on very basic concepts and foundational knowledge. Participants should have attended the courses on “statistical inference I and II” (“Statistik III” and “Statistik IV”), but no explicit prior knowledge on the frequentism, Bayesianism, and fiducialism debates is required. We will work with two modern textbooks [1,2], one of which [2, Part I] especially targets novices unfamiliar with the subject. We also welcome interested minor students in their final year. The seminar will be held in English.
[1] Berger, James, Meng, Xiao-Li, Reid, Nancy, and Xie, Ming-Ge. (Eds.). (2024). Handbook of Bayesian, Fiducial, and Frequentist Inference. CRC Press.
[2] Efron, Bradley, and Trevor Hastie. Computer age statistical inference, algorithms, evidence, and data science. student edition. Cambridge University Press, 2021.
Teacher: Walter J. Radermacher
Runtime: 1. October 2024 - 10. October 2023
Format: Self-learning through online videos in the first week and in-person workshops for practical appliance of use cases in the second week.
Examination: Oral Exam (3 ECTS credits)
Language: English
Who is this course for? MsC Statistics and Data Science (2021, WP 28+29+40+46), BsC Statistics and Data Science (2021, WP 8+11), Statistik und Data Science als Nebenfach für Bachelor 30 ECTS (2021, WP 4+5), Statistik und Data Science als Nebenfach für Bachelor 60 ECTS (2021, WP 11+12), Statistik und Data Science als Nebenfach 30 ECTS Mathematik (2021, WP 5+6), Statistik Nebenfach 60 ECTS Bachelor Soziologie (2021, WP 10+11), WISO Mater (2010, "Ausgewählte Gebiete..." (3ECTS))
Die
Veranstaltung wendet sich an Studierende mit Hauptfach Statistik und
Data Science bzw. Statistik. Das Fortgeschrittene Praxisprojekt (PO
2021) bzw. Statistische Praktikum (PO 2010) ist für Studierende im
Bachelor-Studiengang Statistik ein Pflichtbestandteil des Studiums. In
Gruppen von 4-5 Personen werden Projekte aus der angewandten Statistik
bearbeitet. In der Regel besteht ein Projekt aus statistischen
Fragestellungen, die sich aus der Zusammenarbeit mit externen
Kooperationspartnern ergeben.
Jede Gruppe hält einen
Zwischenvortrag bei dem bisherige Ergebnisse diskutiert und Anreize für
weitere Analyse-Ansätze gegeben werden. Abgeschlossen wird das Praktikum
mit einem längeren Vortrag in Anwesenheit des Projektpartners.
Die Statistik-Kenntnisse aus der Veranstaltung "Einführung in die lineare statistische Modellierung"
bzw. "Lineare Modelle" werden für das Praktikum dringend empfohlen.
Ohne diese Kenntnisse wird eine Bearbeitung der Projekte nicht möglich
sein.
Die Veranstaltung wird sowohl während der Vorlesungszeit als auch in den Semesterferien angeboten. Die fristgerechte Anmeldung bis zum 30.09.2025 ist notwendig und verpflichtend, um eine ausreichende Menge an Projekten vorbereiten zu können. Ohne Anmeldung kann eine Teilnahme nicht garantiert werden. Bei der Anmeldung bitte auf die Angabe der korrekten Prüfungsordnung achten. Bitte beachten Sie, dass das Einschreiben in diesen Kurs keine Anmeldung darstellt.
Einschreibeschlüssel : statp2526
Die Veranstaltung wendet sich an Studierende im Bachelor Statistik & DataScience (3. Semester). Das "Grundlegende Praxisprojekt" (BA Statistik und Data Science - PO 2021) ist eine Pflichtveranstaltung (Modul P 11.1).
Die Veranstaltung wird sowohl während der Vorlesungszeit (in zwei getrennten Termingruppen) als auch in den Semesterferien angeboten. Diese Moodle-Seite ist gemeinsam für alle Veranstaltungen. Für alle drei Blöcke finden Einführungsveranstaltungen mit Anwesenheitspflicht am 13. und 16.10.2025, 16-18 Uhr statt. Aus organisatorischen Gründen ist eine frühzeitige, separate Anmeldung für die Teilnahme während der Vorlesungszeit nötig -- schreiben Sie sich bitte in den Kurs ein und melden Sie sich dann auf der Kursseite für einen der 128 während dem Semester verfügbaren Praktikumsplätze an. Diese Anmeldung ist bis zum 12.10.2025 möglich. Melden Sie sich auch für die Veranstaltung während des Semesters im LSF an.
9 ECTS, 4 SWS Vorlesung, 2 SWS Übung
Primäre Zielgruppe: 3. Semester Bachelor Statistik und Data Science (Module P9 und P10 in SPO 2021)
Inhalte: Einführung ins Schätzen und Testen.
| Termin | Ort | Beginn | |
|---|---|---|---|
| Vorlesung | Dienstag, 16:00 s.t.! - 20:00 | Schellingstr. 3 (S) - S 002 | 14.10.25 |
| Übung (Präsentationen) | Montag, 14:15 - 15:45 | Geschw.-Scholl-Pl. 1 (D) - D 209 | 27.10.25 |
| Übung (Besprechung) | Mittwoch, 10:15 - 11:45 | Geschw.-Scholl-Pl. 1 (M) - M 114 | 15.10.25 |
| Tutorium | Donnerstag, 14:15 - 15:45 | Geschw.-Scholl-Pl. 1 (D) - D 209 | 23.10.25 |
Teacher: Walter J. Radermacher
In-Person Workshops: February 17, February 18, February 19, 10am-5pm each
Format: Self-learning through online videos and in-person workshops for practical appliance of use cases.
Registration period: October 1 - November 7, 2025.
Examination:
Schedule:
| Time | Lecturer | Begin | |
|---|---|---|---|
Lecture |
Monday, 10:15 - 11:45 |
Prof. Dr. Heumann |
13.10.2025 |
| Tutorial |
Tuesday, 08:15 - 09:45 | Jai Lunkad | 14.10.2025 |
| Lecture | Tuesday, 14:15 - 15:45 | Prof. Dr. Heumann |
14.10.2025 |
Exercise course (Group 1) |
Wednesday, 14:15 - 15:45 | Sapargali, Garces Arias |
22.10.2025 |
Exercise course (Group 2) |
Thursday, 08:15 - 09:45 |
Sapargali, Garces Arias |
23.10.2025 |
Dr. Laura Hanemann
Bildungssoziologie
Seminar BA • Wintersemester 2020/2021
Mittwoch 12-14 Uhr c.t. • online
Die Sozialstruktur Deutschlands hat sich in den vergangenen Jahrzehnten, u.a. befördert durch die Bildungsexpansion der 70er Jahre, tiefgreifend verändert (vgl. Vester u. a. 2001). Dennoch belegen zahlreiche Studien, dass die Chancen auf die Teilhabe an Bildung nach wie vor nicht für alle sozialen Gruppen gleich sind. So strukturiert die soziale Herkunft Bildungswege, beispielsweise über die Bildungsentscheidungen, die Eltern für ihre Kinder treffen. Neben der sozialen Herkunft spielen auch das Geschlecht oder ein Migrationshintergrund eine entscheidende Rolle.
Das Seminar geht der Frage nach, wie über gesellschaftlich organisierte Bildung (Schule, Hochschule, Universität) Strukturen gesellschaftlicher Ungleichheit reproduziert oder auch aufgebrochen werden können. Wir beschäftigen uns somit mit einem Feld, das uns auch lebensweltlich nahe ist. Anhand der Lektüre u.a. von empirischen Beiträgen gehen wir verschiedenen Fragen nach, z.B. wie Bildungsungleichheit in der Schule praktisch hergestellt wird oder wie durch Bildung gesellschaftliche Distinktionsmerkmale und darüber (neue) Mechanismen der Reproduktion sozialer Ungleichheit entstehen.
Die Veranstaltung wird wöchentlich als zoom-Seminar stattfinden.
Dr. Laura Hanemann
Wohlfahrtsstaat und Praktiken der Verantwortung
Seminar MA (WP 14/Neuer Master) • Wintersemester 2020/2021
Mittwoch 12-14 Uhr c.t. • online
Im Seminar beschäftigen wir uns mit einer Soziologie des Wohlfahrtsstaates. In einem ersten Schritt gehen wir der Frage nach, was eine soziologische Perspektive auf den Wohlfahrtsstaat ausmacht? Was heißt es, ihn als politische Ordnungsfunktion gesellschaftlicher Verhältnisse zu begreifen und warum gilt der Wohlfahrtsstaat als zentraler Modus politischer Vergesellschaftung?
Von diesen Fragen und Perspektiven ausgehend beschäftigt sich das Seminar in einem zweiten Schritt mit der Arbeit von François Ewald, der nicht vom Wohlfahrtsstaat, sondern vom „Vorsorgestaat“ spricht. Als Schüler und Mitarbeiter von Michel Foucault rekonstruiert Ewald die Entwicklung des modernen Staates als eine Geschichte sogenannter „Praktiken der Verantwortung“. Er zeigt anhand von juristischen Regelungen zum Arbeitsunfall auf, wie das Ereignis des Unfalls nicht mehr in Kategorien der persönlichen Schuld, der Haftung und des nicht planbaren Zufalls, sondern in denen des statistisch berechenbaren Risikos und der Versicherung gedacht wird. Damit einhergehen nicht nur Veränderungen des liberalen Rechts, sondern auch eine individuelle Pflicht zur Vorsorge sowie eine neue normative Ordnung, bei der es kein „Außerhalb der Gesellschaft“ mehr gibt.
Teilnahme und Beteiligung
Die Veranstaltung findet als wöchentliches zoom-Seminar statt. Die regelmäßige Teilnahme, eine mündliche Beteiligung und die gründliche Lektüre der Texte sind obligatorisch.
Teilnahmebedingungen sind:
eine regelmäßige Teilnahme
eine aktive Mitarbeit im Seminar
die Übernahme der Rolle einer bevorzugten Ansprechpartnerin/ eines bevorzugten Ansprechpartners in zwei Seminarsitzungen
Verfassen einer Hausarbeit
In diesem Kurs wird die qualitative Familiensoziologie eingeführt. Fragen der Reproduktion, Regeneration, Arbeitsteilung, Paarfindung, Liebe und Sexualität usw. finden hier unter dem Licht sozialer Differenzen wie Gender eingehende Beachtung. Es soll ein Querschnitt (aktueller) qualitativer Forschung ermöglicht werden.
Ziel ist es, dass die Studierenden einen Einblick gewinnen in zentrale qualitative Methoden und Fragestellungen innerhalb der Familiensoziologie und angrenzender (Teil–)Disziplinen.
Die Anmeldung für diese Veranstaltung ist ausschließlich über LSF möglich! Den Einschreibeschlüssel für den Moodle-Kurs erhalten Sie zu Semesterbeginn.
In diesem Kurs wird in Werk und die Theorie von Hartmut Rosa eingeführt. Fragen der Resonanz als Beziehung zur sozialen und dinglichen Welt, der Beschleunigung als Grundstruktur der Moderne und der Auswirkungen, die daraus erwachsen, werden eingehend betrachtet. Die Frage, wie Geschlecht bei Rosa gedacht werden kann, steht ebenfalls im Raum.
Ziel ist es, dass die Studierenden einen Einblick gewinnen in Rosas Theoriegebilde und Fragestellungen innerhalb der Soziologie damit bearbeiten können.
In der Übung stellen Absolventinnen und Absolventen ihre Abschlussarbeit zum jeweiligen Bearbeitungsstand vor. In der Gruppe werden die Untersuchungen und ihr Fortgang diskutiert. Dabei stehen – je nach Stand der Arbeit – Fragen der Themenspezifikation, Wahl der Methode, des strukturellen Aufbaus, der Literaturauswahl und schließlich der Interpretation der Ergebnisse im Vordergrund. Die von den Studierenden zu haltenden Vorträge ermöglichen die Festigung der eigenen Präsentationskompetenz und schulen die Fähigkeit zur Argumentation. Die anschließende Diskussion hilft, den eigenen Forschungsprozess kritisch zu reflektieren. Wesentliche Arbeitsschritte des wissenschaftlichen Arbeitens werden semesterbegleitend bedarfsgerecht vertieft. |
Einführung in die Soziologie (01)
14-16 Uhr ct.
Zoom-Meeting beitreten
https://lmu-munich.zoom.us/j/95117620749?pwd=TE5ETDFsQXlXMTE3QVlpV0krMTluQT09
Meeting-ID: 951 1762 0749
Kenncode: 627151

Als historische Grundbegriffe charakterisieren "Macht" und "Herrschaft" soziale, politische und kulturelle Beziehungen. Zugleich unterliegen diese Begriffe aber auch einem historischen Wandel, der nicht zuletzt
Das Seminar unternimmt den Versuch, den Wandel der Begriffe zu rekonstruieren, Idealtypen der Herrschaft zu differenzieren sowie konkurrierende Machtkonzeptionen vergleichend zu analysieren. Ins Zentrum rücken Max Webers Herrschaftssoziologie sowie die Machtkonzeptionen von Pierre Bourdieu und Michel Foucault.
Die Rational-Choice-Theorie ist ein sehr verbreiteter Ansatz in den Wirtschaft- und Sozialwissenschaften. In ihrem Fokus stehen Gründe und Folgen des menschlichen Verhaltens, die mit Entscheidungen zwischen konkurrierenden Alternativen in unterschiedlich strukturierten Situationen zu tun haben.
Die Rational-Choice-Theorie erlaubt die Deduktion von empirisch prüfbaren
Aussagen im Rahmen von Modellierungen. Daher werden die Varianten der Theorie
nicht nur vorgestellt und diskutiert, sondern durch Anwendungen aus der
Soziologie, Politikwissenschaft und Ökonomie veranschaulicht. Dabei sollen auch
Anomalien und Weiterentwicklungen des Ansatzes in den Blick genommen werden.
Das Modul „Datenerhebung“ führt in quantitative Forschungsdesigns und Datenerhebungsverfahren ein. Nach
einer Einführung in Grundlagen (Forschungsdesigns, Validität) werden unterschiedliche Designs vertieft: Klassi-
sche Designs wie Experimente und Surveys, einschließlich geeigneter Stichprobenverfahren, aber auch neuere
Verfahren, wie Studien mit „big data“ oder räumliche Analysen mit Georeferenzierungen. Studierende lernen
die Vorteile, aber auch Grenzen unterschiedlicher Designs praktisch anhand von Anwendungsstudien und
Übungsaufgaben kennen. Zudem können Sie Ideen für eigene Forschungsdesigns entwickeln.
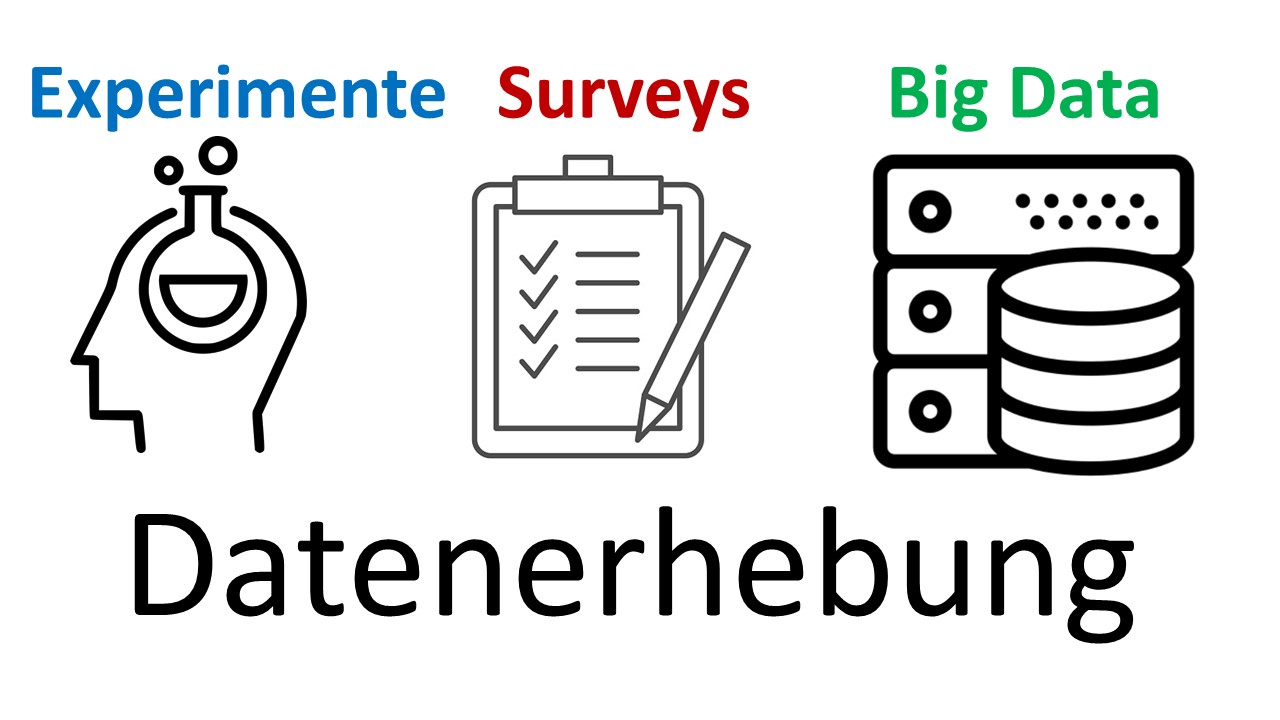
Supertutorium zu den Tutorien der Einführungs-Vorlesung in qualitative Methoden im WiSe 2021/22
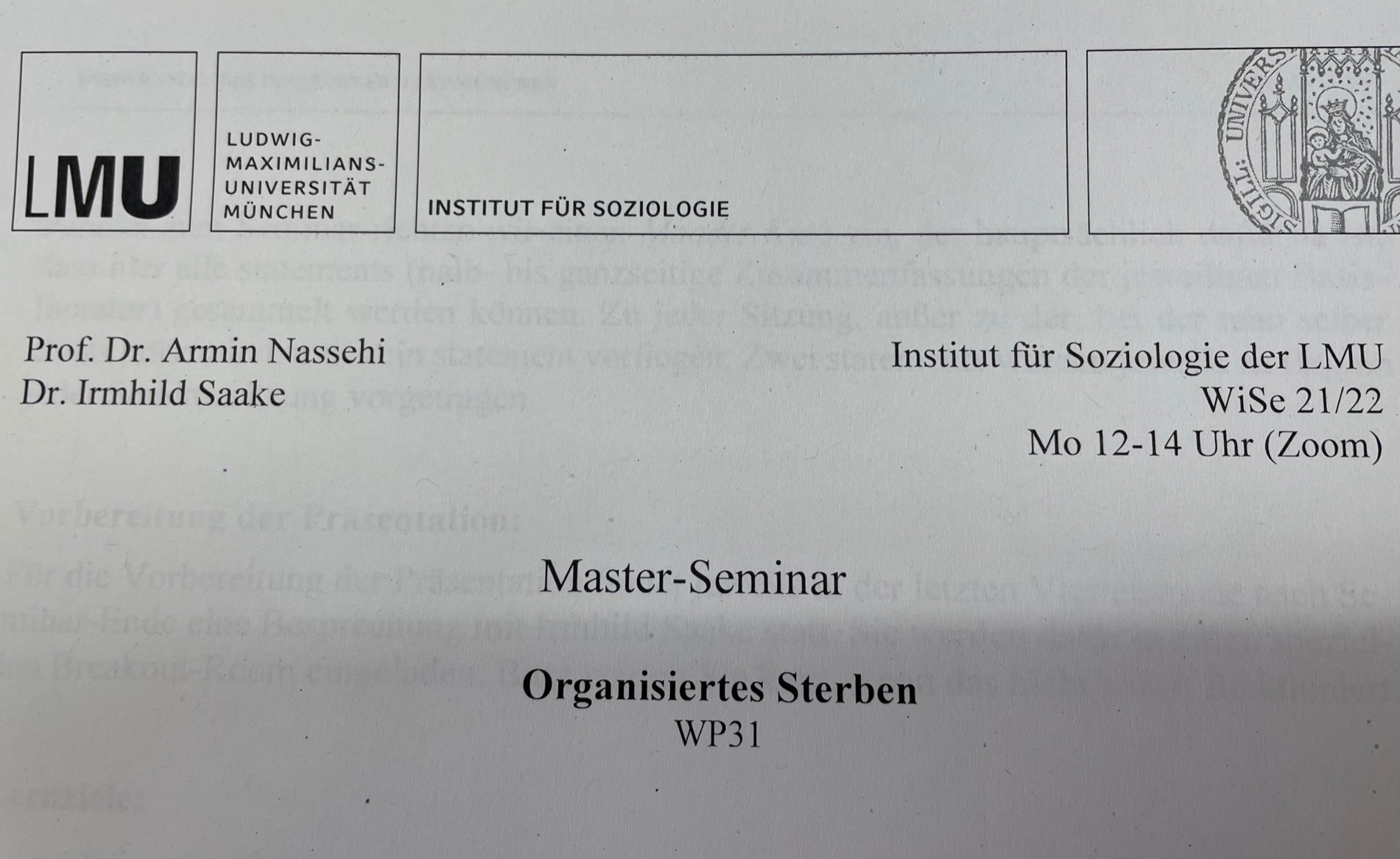
Das Tutorium wird sich aus zwei Einheiten zusammensetzen:
1) Jour fixe: Synchrone ZOOM-Sitzung
Donnerstag, 14.00-16.00 Uhr (c.t.)
Dabei wollen wir uns in einer gemeinsamen ZOOM-Sitzung mit grundlegenden Aspekten zum wissenschaftlichen Arbeiten befassen und uns über diesbezügliche Erfahrungen austauschen:
z.B.
- Wie funktioniert wissenschaftliches Arbeiten?
- Wie kann ich mich bereits während des Semesters auf Hausarbeiten vorbereiten?
- Wie finde ich ein Thema? Wie entwickle ich eine Fragestellung?
- Wie baue ich meine Arbeit auf?
- Wie suche und finde ich passende Literatur?
- Welche Formalia sollte ich beachten?
- Welche praktischen Tipps können mir das Vorgehen erleichtern?
- etc.
Um das Angebot an eure Bedürfnisse anpassen zu können, könnt ihr mir selbstverständlich jetzt im Vorfeld und jederzeit Fragen oder Wünsche per Mail zukommen lassen, auf die im Rahmen des Tutoriums eingegangen werden soll.
Für die ZOOM-Sitzungen werden wir folgende Zugangsdaten verwenden:
Thema: Tutorium zum wissenschaftlichen Arbeiten (Sprachwissenschaft)
Uhrzeit: 21. Oktober.2021 14:00 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien
Zoom-Meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/82822186014?pwd=SGp6VWhsdlBUaE9Xbm9Ka2xrdTMzZz09#success
Meeting-ID: 870 9600 5611
Kenncode: L2ng02st1k
Die Teilnahme am Tutorium ist freiwillig und es können keine ECTS-Punkte erworben werden.
Die wichtigsten Inhalte werden auf MOODLE (Zugangsdaten folgen) zur Verfügung stehen.
2) Individuelle Beratung:
Da womöglich manche von euch nicht am fixen Termin teilnehmen können, aber auch um noch genauer und individueller auf eure Arbeiten/Fragen eingehen zu können, stehe ich euch für virtuelle Einzelberatungen zur Verfügung, die wir in gemeinsamer Absprache vereinbaren können. Das gibt uns auch den Raum, um zusammen einen Blick auf eure Arbeiten zu werfen und spezielle Fragen zu klären.
Für Rückfragen stehe ich euch jederzeit zur Verfügung: sebastian.wittkopf@campus.lmu.de
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und den Austausch mit euch in diesem Wintersemester 2021/2022!

New tools powered by artificial intelligence (AI) are increasingly developed and deployed in (local) journalism. Against this background, understanding audiences’ perceptions of AI is essential, as the acceptance or rejection of AI in news production can translate into public trust or distrust in journalism (Robertson & Ridge-Newman, 2022). Indeed, there are concerns about accuracy, biases, and privacy, which can be subsumed under the headings of algorithmic appreciation (Joris et al., 2021) or algorithmic aversion (Mahmud et al., 2022).
This seminar will investigate AI's perceived benefits and drawbacks in local journalism by employing focus groups and interviews with audience members. A particular reference point will be the concept of algorithmic folk theories (Ytre-Arne & Moe, 2021) to explore the perceptions of AI in local journalism by different audiences.
Das Seminar widmet sich den
Veränderungen im politischen Diskurs der späten Sowjetunion und des
postsowjetischen Russlands, die mit dem Instrumentarium der klassischen,
aristotelischen Rhetoriklehre untersucht werden sollen. Anhand exemplarischer
Reden von Michail Gorbacëv, Boris El’cyn und Vladimir Putin werden wir
Entstehung und Entwicklung von neuen Formen politischer Rhetorik in
Wechselwirkung mit einem neuen politischen System durchleuchten. Nicht die
(wissenschaftlich obsolete) Unterscheidung zwischen guter und schlechter
Rhetorik, Dialogizität und Manipulation steht im Zentrum des Seminars; vielmehr
sollen unterschiedliche Funktionsweisen politischer Rede erläutert werden, die
erst durch eine strukturelle Analyse ersichtlich werden können. Dabei sollen
auch mediale und performative Aspekte politischer Rhetorik berücksichtigt
werden.
Gute Russischkenntnisse werden vorausgesetzt.

Digitales Forum für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Unitags im Wintersemester 2021/22
Hier finden sich außerdem das Programm, wichtige Links und Materialien.

Die empirischen Wissenschaften stehen vor wesentlichen Herausforderungen in Bezug auf die Reproduzierbarkeit und Replizierbarkeit ihrer Ergebnisse. Die sogenannte Replikationskrise beschreibt das Phänomen, dass eine Vielzahl an Studienergebnissen nicht auf unabhängigen Daten bestätigt werden können.
Dies liegt unter anderem an der Tatsache, dass in der Regel eine große Anzahl an verschiedenen Analysestrategien für eine bestimmte Forschungsfrage existiert (>>researcher degrees of freedom<<). Überdies werden die Ergebnisse oftmals nur selektiv für die gewählte Strategie veröffentlicht und die Variabilität in Bezug auf verschiedene andere Ansätze verschleiert (>>selective reporting<<).
Schwerpunkt des Seminars ist die Vermittlung von Grundlagen der Reproduzierbarkeit und Replikation in der Statistik. Die Studierenden werden dazu in die entsprechende Literatur und den Umgang mit geeigneten Tools, wie z.B. Git/Github (Versionskontrolle) und R Markdown (Reporting) eingeführt, um anschließend selbstständig an einer vorgegebenen Fragestellung (unter Einbezug der einschlägigen Literatur) zu arbeiten.
Vorbesprechung: Freitag, 22.10.2021 um 14:00-16:00 Uhr (s.t.) via Zoom
Einführungs-Kurs: Freitag 29.10.2021, 14:00-16:00 Uhr (s.t.) via Zoom
Ort: Das Seminar findet vsl. via Zoom statt.
Anrechnung: 6 ECTS oder 9 ECTS (6 ECTS (Seminar) + 3 ECTS (Wahlpflichtbereich))
Die Vorlesung befasst sich mit multimedialen Dienstangeboten, die über Datennetze realisiert werden. Die Vorlesung befasst sich mit folgenden Themen:

Termine
Termine:
| Termin | Ort | Person | Beginn | |
|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | Mo, 10:15-11:45 Do, 10:15-11:45 (14-tägig) |
[Sowohl virtuell als auch in Präsenz] Geschw.-Sch.-Pl. 1 - B 106 Theresienstr. 39 - B 134 |
Benjamin Sischka |
18.10.2021 |
| Übung |
Mo/Do, 10:15-11:45 (14-tägig) | Virtuell via Zoom |
Malte Nalenz |
28.10.2021 |
Die Lehrveranstaltung, die als Ringvorlesung stattfinden wird, soll die Rolle der Naturwissenschaften und der Digital Humanities in den Historischen Grundwissenschaften beleuchten. Die Vortragenden, durchweg international bekannte Spezialistinnen und Spezialisten in ihren Fachbereichen, werden u. a. zu Palimpsesten und Möglichkeiten ihrer materialtechnologischen Auswertung, zur Rolle der Digital Humanities in der Wasserzeichenforschung, zur Fragmentforschung und zur automatischen Schrifterkennung sprechen. Das genaue Programm findet sich hier:
https://www.hgw.geschichte.uni-muenchen.de/aktuelles/termine/ringvorlesung_2021-22/index.html
Im Rahmen des Historikertags 2021 in München sollen
in Form einer Vitrinenausstellung die bekanntesten Stücke (insbesondere
Handschriften, aber auch Karten) aus der Sammlung der Münchener
Universitätsbibliothek präsentiert werden. Die Lehrveranstaltung dient der
Gestaltung dieser Ausstellung: Ziel ist, zunächst die Bedeutung und die
Wirkungsgeschichte der betreffenden Objekte zu erschließen, ehe in einem
zweiten Schritt überlegt werden soll, wie das jeweilige Exponat in der
Ausstellung am wirkungsvollsten präsentiert und mit welchen Begleittexten es
einer breiteren Öffentlichkeit erschlossen werden kann.
Im Kooperationsprojekt des Instituts für Kunstpädagogik mit dem Haus der Kunst sollen zur Ausstellung Phyllida Barlow kunstpädagogische Vermittlungskonzepte entwickelt und umgesetzt werden. Diese werden in einer Aktionswoche (12.-18.07.) durchgeführt. Die Themen und Inhalte des Haus der Kunst können so spannend neu verhandelt werden – digital und doch sinnlich, ästhetisch und motivierend!
Kurszeiten:
Wöchentlich 22.04. bis 22.07.2021 je Donnerstags 14:15-16:30 Uhr per Zoom:
Kontakt per E-Mail
Anja Gebauer: anja.gebauer@lmu.de (Bitte nur in dringenden Fällen, Fragen bitte im Forum "Fragen" stellen!)
Sandra Falkenstein: sandra.falkenstein@lmu.de
Allgemeine Hinweise zu Videokonferenzen

Im Rahmen dieser Lehrveranstaltung, die sich aus einzelnen Vorträgen der Dozent*innen des Instituts für Kunstpädagogik zusammensetzt, erhalten die Studierenden einen Überblick über zentrale Inhalte der Kunstpädagogik. Die Prüfungsleistung wird in Form einer Klausur erbracht. In der Woche vor der Klausur (05.07.2021) findet eine Probeklausur (28.06.2021) statt.
Mitte des letzten Jahres zeichnete die Stadt München Jörg Widmann (*1973) mit ihrem Musikpreis aus und ehrt damit "einen universalen Musiker, der als Instrumentalist, Komponist und Dirigent eine Ausnahmeerscheinung in der internationalen Klassikszene ist" (Pressemeldung).
Seine vielfältigen Tätigkeitsfelder als weltweit gefragter Klarinettist, Komponist und Dirigent, aber auch als Lehrender und Musikvermittler, lassen ihn als geradezu ideale Persönlichkeit erscheinen, um mit ihm einen Blick in die Musikgeschichte zu werfen und eine "lebendige Aufführungspraxis" der Musik vergangener Jahrhunderte zu diskutieren.
Im Seminar soll Widmanns kompositorische Auseinandersetzung mit Werken anderer Komponist:innen im Fokus stehen, wobei diese selbstredend durch seine aktive Musikerkarriere beeinflusst wird. Seine Klavierzyklen können als Referenzen auf Schubert, Schumann und Brahms verstanden werden, seine Solokonzert scheinen von den Schatten früherer Kompositionen begleitet zu werden und seine jüngsten Streichquartette werden bewusst als "Studien über Beethoven" bezeichnet. Gemeinsam soll herausgearbeitet werden, wie Widmann trotz spielerischer Anklänge und Scheinparallelen gerade eine Différance herausarbeiten möchte, die einen frischen Blick auf die Musikgeschichte evoziert.
Ähnlich zu seinen "Zeitensprüngen", die er anlässlich des 450jährigen Bestehens der Staatskapelle Berlin 2019/20 komponierte, soll gemeinsam der Bogen aus dem 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart geschlagen und die "Rückschau auf die Historie" mit einer "Tuchfühlung zur Gegenwart" verbunden werden. Neben den Werken Widmanns sollen hierbei beispielsweise Kompositionen von J. S. Bach, L. v. Beethoven, J. Brahms, J. Haydn, F. Mendelssohn-Bartholdy, W. A. Mozart, N. Paganini, F. Schubert, R. Schumann sowie Werke aus der Moderne besprochen werden, zugleich aber auch Einflüsse von der Folklore über Jazz bis zur Techno-Musik der 1990er Jahre aufgezeigt werden.
Neben Konzertbesuchen, als Ergänzung zu den Seminarinhalten, ist ein Gespräch mit dem Komponisten ebenso angedacht wie eines mit einer Interpretin seiner Werke.

Wir werden uns zunächst per Lektüre und Diskussion einen kleinen Einblick in grundlegende physikalische Eigenschaften des Schalls erarbeiten. Derart ausgerüstet, wagen wir uns sodann an ausgewählte Themen der Akustik und Psychoakustik heran – Stichworte sind: Klangerzeugung der Musikinstrumente und der menschlichen Stimme, Funktion des menschlichen Hörapparates, Klangwahrnehmung und Empfindungsgrößen, Klangfarbe, Konsonanz und Dissonanz, Tonsysteme und Stimmungssysteme, Klangsynthese und -analyse, Akustik von Räumen, elektronische Musik. Außerdem können wir geeignete Themen, die sich aus den Interessen der Teilnehmerinnen und -nehmer ergeben, aufgreifen. Wegen der erfreulichen Resonanz beim letzten Kurs werden wir auch diesmal wieder – soweit wir in Präsenz arbeiten können – anhand einer kleinen Versuchsanordnung und mit Hilfe von allerlei "musikalischen" Gegenständen aus meinem Haushalt das eine oder andere Angelesene experimentell überprüfen, gutheißen, verwerfen... Der Lektürekurs ist offen für alle. Voraussetzung für die Teilnahme ist lediglich die Bereitschaft, die jeweiligen Texte zuhause aufmerksam durchzulesen und gelegentlich eine kurze Zusammenfassung vorzubereiten. |


Das Seminar wir sich Coronabedingt mit der Probliematik sowie den Möglichkeiten des Distanz- und/oder Hybridlernens im Fach Kunst beschäftigen.
Zur Vorbesprechung im Januar 2021 werden alle Teilnehmer/innen gesondert eingeladen.
Das Begleitseminar Kunst öffentlich machen erstreckt sich über zwei Semester. Sie erarbeiten im Wintersemester 2020/21 ein gemeinsames Portfolio zur Vorbereitung der Abschlussausstellung. Sie planen Ihre Abschlussausstellung und die begleitende Publikation für das Sommersemester 2021 und lernen so Methoden der Ausstellungspraxis kennen. Begleitend erfahren Sie verschiedene theoretische Positionen des Ausstellens. Im Sommersemester 2021 wird das Seminar fortgesetzt: Sie realisieren dann Ihre Abschlussausstellung und die begleitende Publikation.
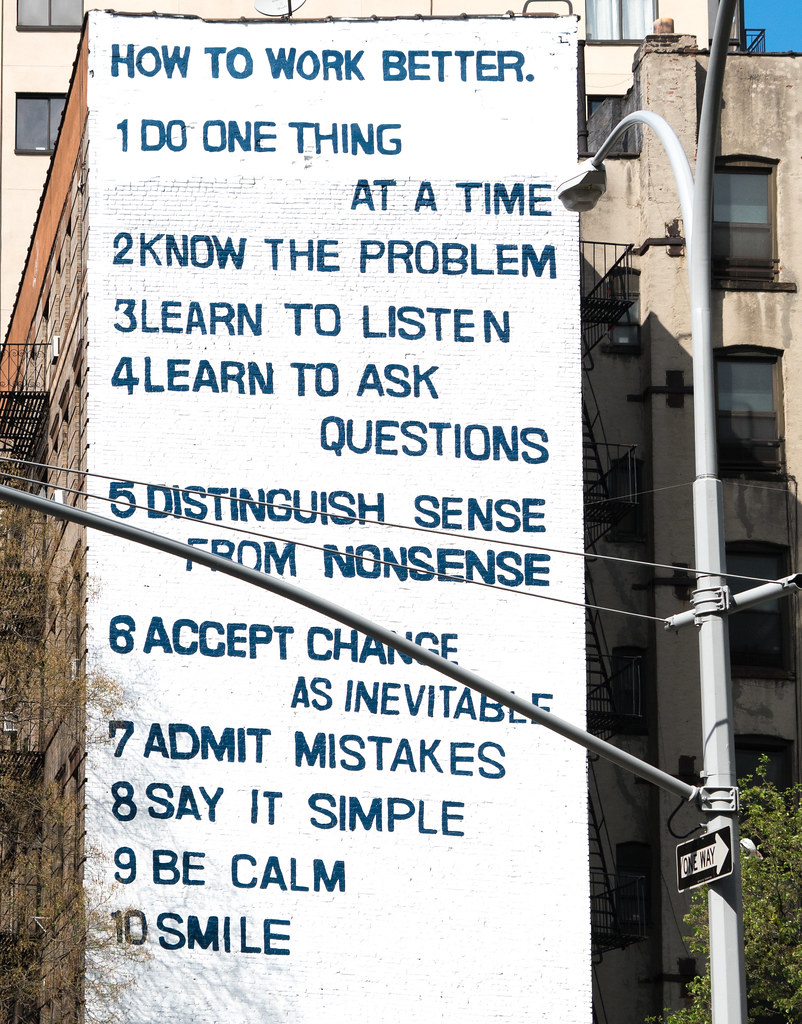
[...] Der Design Workshop 2 wird im Sommersemester 2021 online stattfinden. Ziel des Workshops ist es, eine VR-App zu entwickeln, die dem Fahrgast das Erlebnis einer vernetzten Reise mit anderen ermöglicht. Wie kommt man aus dem engen Raum der Verkehrsmittel heraus, um soziale Kontakte mit anderen in einer potentiell unbegrenzt großen, virtuellen Umgebung zu knüpfen? Wir werden die Anforderungen und den Interaktionsrahmen dieses Anwendungsfalls untersuchen und dann in den Design- und Entwicklungsprozess einfließen lassen. [...]
Unterrichtsformat
Diese Veranstaltung findet nach Möglichkeit IN PRÄSENZ statt.
Empfohlene Voraussetzungen
Erfolgreiche Teilnahme an den Kursen "Grundlagen der Satzlehre, Instrumentale Formenlehre und Vokale Formenlehre.
Empfohlene weitere Veranstaltungen
Diese Übung baut auf und knüpft an die am Freitag stattfindende Übung Satz- und Kompositionstechniken des 18. und 19. Jahrhunderts. Der Besuch sowohl dieser Übung als auch das beide Veranstaltungen abdeckende Tutorium wird dringend angeraten.
Kommentar
Methoden zur Analyse ausgewählter repräsentativer Werke des 20. Jahrhunderts.
Bild: IPS

Dieses besondere Kooperationsprojekt findet in der Spielzeit 22/23 seine inzwischen fünfte Auflage: Für ein Konzert der Münchner Philharmoniker wird von den Studierenden ein komplettes Programmheft gestaltet – von der ersten konzeptionellen Idee über das Realisieren aller Texte bis zum Korrekturlesen im fertigen Layout. Neben klassischeren Texten ist hier auch immer viel Raum für neue oder ungewöhnliche Ideen.
Der Kurs verfolgt dabei zwei Schienen: Zum einen werden die Stücke des Konzerts und ihre Hintergründe gemeinsam erschlossen, um dann in gemeinsamer Diskussion spannende Themen und wirkungsvolle Erzählansätze zu finden, welche das Konzertpublikum bereichern. Zum anderen werden verschiedene Programmhefte kritisch analysiert sowie Übungstexte verfasst, um einen Weg zu finden, für ein Publikum von heute zeitgemäß zu schreiben. Beide Ansätze vereinen sich dann im, immer wieder mit professionellen Feedback versehenen, Verfassen des eigenen Beitrags für „unser“ Programmheft.
Konzertprogramm
FRANZ SCHUBERT: Ouvertüre zu "Rosamunde, Fürstin von Zypern" C-Dur D 797
RICHARD STRAUSS: Duett-Concertino F-Dur für Klarinette, Fagott und Orchester
CLAUDE DEBUSSY : "La Mer"
MAURICE RAVEL : "Daphnis et Chloé", Suite Nr. 2
ZUBIN MEHTA – Dirigent
ALEXANDRA GRUBER – Klarinette
RAFFAELE GIANNOTTI – Fagott
Zeitplan
Fr., 21.10.2022, 12-14: Auftaktsitzung gemeinsam mit Rebecca Friedman und Christine Möller von den Münchner Philharmonikern (Spielfeld Klassik bzw. Programmheftredaktion)
Fr., 04.11.2022, 12-16: Konzertprogramm I (Schubert, Debussy), Analyse Programmhefttexte I
Fr., 25.11.2022, 12-16: Konzertprogramm II (Strauss, Ravel), Analyse Programmhefttexte II
Fr., 09.12.2022, 12-14: Besprechung Übungstexte
Fr., 16.12.2021, 10(?)-16: Probenbesuch vormittags (angefragt), Konzeption eigenes Programmheft
Fr., 20.01.2023, 12-16: Präsentation und Diskussion der einzelnen Texte/Beiträge
Abgabe der Texte: spätestens 23.03.2023
Überarbeitung der Texte durch die Studierenden: 01.04. bis spätestens 17.04.2023
Korrekturfahne im Mai 2023
Konzerte am 08. und 09.06.2023 (am 09.06. gemeinsamer Konzertbesuch)
Bildquelle
Im Seminar erarbeiten wir Aspekte digital-ästhetischer Souveränität als Grundlage für kunstpädagogische Handlungskontexte in schulischer Praxis.
Es werden zunächst in einer Reihe gestalterischer Projektarbeiten eigene Perspektiven entwickelt - Was bedeutet digitale Souveränität für uns?
Sie bekommen Einblicke in folgende Gestaltungsmedien und -gestalterische Ansätze: Augmented Reality (Adobe Aero), Crossover, Künstliche Intelligenz und Bildgeneration, Creative Coding, Robotics/Zeichenrobotic, Making (vielfältige Gestaltungsmedien ihrer Wahl).
Sie können in ihrem gestalterischen Projekt einen Schwerpunkt in Anlehnung an folgende Themenkomplexe wählen:
Fokus I Dimensionen digitalen Souveränität und Subjekt/Selbstdarstellung (auch via Social Media und entsprechenden Ästhetiken/Praktiken).
Fokus II Dimensionen digitaler Souveränität und Im-materialität auch im Kontext von Nachhaltigkeit (digitale Technologien & Materie/Ressourcen).
Fokus III Inklusion / Exklusion durch Digitalität, Fragen der Partizipation z.B. inklusive Schulräume im Crossover Digital/Haptisch gestalten
Positionen aktueller Medienkünstler*innen werden hier als Inspiration einfließen, u.a. insbesondere postdigitale künstlerische Positionen welche Fragen der Souveränität beleuchten (Lauren Mc Carthy u.a.)
Im Seminar beschäftigen wir uns schließlich mit E-learning als Teil der Kunstunterrichtskonzeption sowie im Bereich Fortbildungsdesign für Kunstlehrkräfte.
Konkret werden einerseits bestehende digital gestützte Lehr-lernformate gemeinsam evaluiert und anschließend ausgewählte Inhalte als Teil eines Fortbildungsangebots für Kunstlehrkräfte gestaltet.
LITERATUR
Ackermann, J., & Egger, B. (Hrsg.). (2021). Transdisziplinäre Begegnungen zwischen postdigitaler Kunst und Kultureller Bildung: Perspektiven aus Wissenschaft, Kunst und Vermittlung. Springer VS.
Unterberg, L., & Zulaica y Mugica, M. (2023). Der Button und die Inszenierung des Schaltens. Überlegungen zu einer ästhetischen Souveränität. In Digitalisierte Lebenswelten: Bildungstheoretische Reflexionen (pp. 165-185). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
Fortbildungen:
https://www.friedrich-verlag.de/personen/profil/lars-zumbansen-140/
https://www.youtube.com/watch?v=it6t9NKx-Ho
Künstlerische Positionen
https://lauren-mccarthy.com/Follower
http://www.mattivainio.com/project/systems/

Das Artist in Residence Programm am Institut für Kunstpädagogik zielt auf eine wirksame Kooperation zwischen Wissenschaft, Kunst und Kultur. Im Januar/Februar 2021 wird die türkischstämmige Performance-Künstlerin Nezaket Ekici innerhalb dieses Programms eine Ausstellung in der „Bayerischen Akademie der Schönen Künste“ bespielen. (...)
Das Tutorium ist begleitend zu den Hauptseminaren von Dr. Agathe Schmiddunser und Madoka Yuki. Der erste Termin findet am 27.04.2021 (10.00 c.t) statt. Das Tutorium findet im 14-tägigen Turnus statt.
This course presents and analyses financial options, such as European options and American options. Students will learn how to price options using the binomial option pricing technique as well as the Black-Scholes option pricing formula. Risk-neutral probabilities will be introduced. This course also discusses risks related to commodity prices, exchange rates as well as interest rates, and studies how to manage/hedge such risks. The efficient portfolio choice problem and the Capital Asset Pricing Model will be recapped at the beginning of the course.
All lectures and tutorials are recorded and uploaded to LMUcast. You can access the course material here.
Questions can be either asked via Moodle or Email at kontakt.risk@bwl.lmu.de.The lecture will cover the following topics:
The course will be taught in English.
The course will provide an overview of advanced topics in computer graphics not currently covered by other LMU courses. In particular:
This subject does not count towards a Vertiefende Themen der Informatik/Medieninformatik für Bachelor.
Veranstaltungszeit: Blockveranstaltung
Mi., 09–18 Uhr c.t. (10.12.2021 - 12.12.2022)
Einschreibeschlüssel: folgt
Prof. Dr. Ulrich Schroth auf der Fakultätshomepage
Veranstaltungszeit: Blockveranstaltung
Mi., 09–18 Uhr c.t. (10.12.2021 - 12.12.2022)
Einschreibeschlüssel: folgt
Prof. Dr. Ulrich Schroth auf der Fakultätshomepage
The
course gives an overview on basic concepts of data structures and
general principles of algorithmic design. The general algorithmic
paradigms will be examined based on the classical problems of searching,
sorting and classical graph problems like shortest path or minimal
spanning trees. Finally, the course will give an introduction to the
general methodology of programming.
Computer Games and Games related formats are an essential branch of the
media industry with sales exceeding those of the music or the movie
industry. In many games, it is necessary to build up a dynamic
environment with autonomously acting entities. This comprises any types
of mobile objects, non-player characters, computer opponents or the
dynamics of the environment itself. To model these elements, techniques
from the area of Artificial Intelligence allow for modelling adaptive
environments with interesting dynamics. From the point of view of AI
Research, games currently provide multiple environments which allow to
develop breakthrough technology in Artificial Intelligence and Deep
Learning. Projects like OpenAIGym, AlphaGo, OpenAI5 or Alpha-Star earned
a lot of attention in the AI research community as well as in the broad
public. The reason for the importance of games for developing
autonomous systems is that games provide environments usually allowing
fast throughputs and provide clearly defined tasks for a learning agent
to accomplish. The lecture provides an overview of techniques for
building up environment engines and making these suitable for
largescale, high-throughput games and simulations. Furthermore, we will
discuss the foundations of modelling agent behaviour and how to evaluate
it in deterministic and non-deterministic settings. Based on this
formalisms, we will discuss how to analyse and predict agent or player
behaviour. Finally, we will introduce various techniques for optimizing
agent behaviour such as sequential planning and reinforcement learning.
Veranstaltungszeit: Mittwochs, 16:30 s.t. – 18:00 (ab 20.10.2021)
Einschreibeschlüssel: folgt
Beatrice Bergero auf der Fakultätshomepage
Ziele und Schwerpunkte: Im Zentrum steht die Lektüre einzelner Briefe oder Passagen aus längeren Briefen aus dem Corpus der Briefe an Lucilius, die im ersten Band der Oxford-Ausgabe enthalten sind (1-88). Neben den auf die Form gerichteten Fragen (Eigenheiten der Sprache Senecas, Funktion der Briefform) sollen anhand der Lektüre die Charakteristika der stoischen Philosophie, im Besonderen der Ethik, wie sie Seneca darlegt, herausgearbeitet werden. Dazu gehören die Frage nach der theoretischen Fundierung, nach der praktischen Relevanz sowie nach dem möglichen Bezug zur historischen Wirklichkeit (Seneca als ehem. Erzieher Neros und Minister am neronischen Kaiserhof).
Methode und Leistungsausweis: In den einzelnen Sitzungsleitungen, die von den Studierenden übernommen werden, werden ausgewählte Textpartien gelesen und diskutiert. Zum Leistungsausweis gehören die gründliche Vorbereitung, eine Sitzungsleitung, ein Kurzreferat und die aktive Teilnahme sowie mündliche Prüfung. Für die Sitzungsleitung ist eine schriftliche Übersetzung einer ausgewählten Textpassage vorzubereiten, die eine Woche vorher abgegeben wird und mit Prof. Fuhrer mind. 2-3 Tage vor der Sitzung besprochen wird.
Der Stoff des Seminars ist in Modul 4 Gegenstand
der mündlichen Prüfung (30 Min.).
Textausgabe: Ad Lucilium epistulae morales, recognovit et adnotatione critica instruxit L. D. Reynolds, Band 1 (Oxford 81987).
Empfohlene Literatur zur Vorbereitung: G. Maurach, Seneca: Leben und Werk (Darmstadt, 5., durchges. und erw. Aufl., 2007).
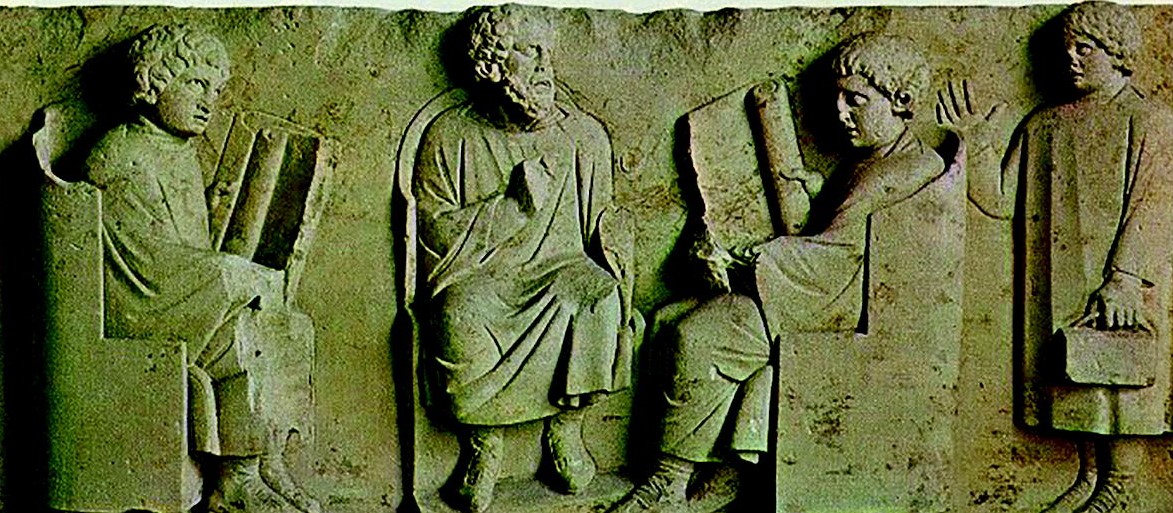
Baudelaires ‚Blumen‘ und das ‚Böse‘
Charles Baudelaire (1821–1867) ist mit seinen Fleurs du Mal (1857/1861) in die Weltliteratur eingegangen und bestimmt seither das literarische Feld unausweichlich. Angesehen als der Begründer der modernité revolutionierte er nicht nur die lyrische Ästhetik, sondern etablierte auch außerhalb des künstlerischen Feldes eine Ästhetik der Moderne, welche das rezente Zeit- und Geschichtsbewusstsein schonungslos artikuliert. Doch eben dieses radikale Epochenbewusstsein und seine ‚unverblümte‘ ästhetische Umsetzung in seinen Blumen des Bösen führten nach der Erstauflage zu Missinterpretationen durch die Öffentlichkeit, zur Verurteilung des Dichters und zum Verbot des Gedichtbandes: Baudelaire wurde zum (gefeierten) Skandalautor.
In diesem Proseminar sollen Baudelaires Blumen und sein Böses semantisch erforscht und seine Poetologie analysiert werden. Den Rahmen dabei bilden eine Auswahl seiner kunsttheoretischen Schriften und Essays sowie die einschlägigen Baudelaire-Lektüren von Walter Benjamin, Hugo Friedrich und Karlheinz Stierle. Neben der Zusammenführung Baudelaires literarischen und theoretischen Schriften, liegt der zentrale Fokus der (Motiv-)Analyse und Interpretation auf der Kontextualisierung der Gedichte innerhalb der präzise erarbeiteten Gesamtkomposition des Gedichtzyklus’; er selbst hat dies folgendermaßen proklamiert:
"Le seul éloge que je sollicite pour ce livre est qu’il n’est pas un pur album et qu’il a un commencement et une fin."
"Le livre doit être jugé dans son ensemble."
Zur Anschaffung wird daher empfohlen:
Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal / Die Blumen des Bösen, frz. u. dt., übers. v. Simon Werle, Reinbek 2017.
Zur Lektüre vorab wird empfohlen:
Walter Benjamin, Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus, Suhrkamp 2019.
Hugo Friedrich, Die Struktur der modernen Lyrik. Von Baudelaire bis zur Gegenwart, Rowohlt 1956.
Karlheinz Stierle, Der Mythos von Paris. Zeichen und Bewußtsein der Stadt, Suhrkamp 2021.
In diesem Seminar geht es um die Konzeption, Realisierung und
Besprechung eines eigenständig durchgeführten kleinen
"Medienkunst-Projekts". Alle Teilnehmer arbeiten weitgehend nach einer
eigenen Idee und einem eigenen Plan. Im Begleitseminar wird als
Zoom-Sitzung ca. alle 14 Tage die Entwicklung der einzelnen Projekte
besprochen. Am Ende werden die Ergebnisse (virtuell) im Seminar
präsentiert.
Das Biologiestudium öffnet die Tür zu einer Vielfalt an
Berufsfeldern! Die rechtzeitige Orientierung über Berufsbilder ist für
alle Studierenden essentiell. In dieser Vorlesungsreihe stellen
Biologinnen und Biologen ihren beruflichen Werdegang vor, berichten aus
ihrer beruflichen Praxis und geben Tipps zum Berufseinstieg. Sie wurde 2017 von Frau Dr. Timea Neusser ins Leben gerufen und wird
seit 2021 von einer Studierendengruppe im Auftrag des Arbeitskreises
Berufsorientierung der Fakultät für Biologie organisiert.
Diese Veranstaltung richtet sich an Studierende aller Semester. Der dokumentierte Besuch von 25 Veranstaltungen kann als berufsqualifizierende Veranstaltung (Studiengänge Bachelor und Master) im Umfang von 3 ECTS angerechnet werden. Diese Vorlesungsreihe ist kein Ersatz für die wissenschaftlichen Vorträge im Studiengang Master!
In almost all areas of business, industry, science, and everybody's
life, the amount of available data that contains value and knowledge is
immense and fast growing. However, turning data into information,
information into knowledge, and knowledge into value is challenging.To
extract the knowledge, the data needs to be stored, managed, and
analyzed. Thereby, we not only have to cope with increasing amount of
data, but also with increasing velocity, i.e., data streamed in high
rates, with heterogeneous data sources and also more and more have to
take data quality and reliability of data and information into account.
These properties referring to the four V's (Volume, Velocity, Variety,
and Veracity) are the key properties of "Big Data". Big Data grows
faster than our ability to process the data, so we need new
architectures, algorithms and approaches for managing, processing, and
analyzing Big Data that goes beyond traditional concepts for knowledge
discovery and data mining. This course introduces Big Data, challenges associated with Big Data,
and basic concepts for Big Data Management and Big Data Analytics which
are important components in the new and popular field Data Science.
In almost all areas of business, industry, science, and everybody's life, the amount of available data that contains value and knowledge is immense and fast growing. However, turning data into information, information into knowledge, and knowledge into value is challenging.To extract the knowledge, the data needs to be stored, managed, and analyzed. Thereby, we not only have to cope with increasing amount of data, but also with increasing velocity, i.e., data streamed in high rates, with heterogeneous data sources and also more and more have to take data quality and reliability of data and information into account. These properties referring to the four V's (Volume, Velocity, Variety, and Veracity) are the key properties of "Big Data". Big Data grows faster than our ability to process the data, so we need new architectures, algorithms and approaches for managing, processing, and analyzing Big Data that goes beyond traditional concepts for knowledge discovery and data mining. This course introduces Big Data, challenges associated with Big Data, and basic concepts for Big Data Management and Big Data Analytics which are important components in the new and popular field Data Science.
Veranstaltungszeit: Freitag, 12:00 c.t. – 14:00 (ab 12.10.2021)
Einschreibeschlüssel: folgt
Susan Byron auf der Fakultätshomepage
Veranstaltungszeit: Freitag, 14:00 s.t. – 16:00 (ab 12.10.2021)
Einschreibeschlüssel: folgt
Susan Byron auf der Fakultätshomepage
Veranstaltungszeit: Blockveranstaltung
Montag, 10:00 s.t. – 16:00 s.t. am 21.02.2022
Dienstag, 10:00 s.t. – 16:00 am 22.03.2022
Mittwoch, 10:00 s.t. – 16:00 am 23.03.2022
Donnerstag, 10:00 s.t. – 16:00 am 24.03.2022
Freitag, 10:00 s.t. – 16:00 am 25.03.2022
Einschreibeschlüssel: folgt
Casey, David, LLB (Hons) auf der Fakultätshomepage
Veranstaltungszeit: Dienstags, 18:00 c.t. – 20:00 c.t. (ab 19.10.2021)
Einschreibeschlüssel: folgt
Veranstaltungszeit: Blockveranstaltung, 10:00 s.t. – 16:00 s.t. ( 23.08.2021 – 27.08.2021)
Einschreibeschlüssel: folgt
David Casey, LLB (Hons) auf der Fakultätshomepage
Veranstaltungszeit: Blockveranstaltung
Montag, 08:30 s.t. – 13:30 s.t. am 14.02.2022
Dienstag, 08:30 s.t. – 13:30 am 15.02.2022
Mittwoch, 08:30 s.t. – 13:30 am 16.02.2022
Donnerstag, 08:30 s.t. – 13:30 am 17.02.2022
Freitag, 08:30 s.t. – 13:30 am 18.02.2022
Einschreibeschlüssel: folgt
Melanie Unseld auf der Fakultätshomepage
We will discuss the body of knowledge in international media research ranging from the Theories of the Press (Siebert et al., 1956) over Comparing Media Systems (Hallin & Mancini 2004, 2011) to Worlds of Journalism (Hanitzsch, Hanusch, et al., 2019). In addition, students get familiar with the empirical methods of journalism studies. As a relevant issue, we focus on the “Global Trust Deficit Disorder” in and between nation-states (Flew, 2021; Hanitzsch & Van Dalen et al., 2018). Public Scholarship aims to address global injustices, understand the public, and co-create new and unconventional knowledge for a better world (Waisbord, 2020; Billard & Waisbord, 2024). In doing so, we combine the Future Lab Method (Jungk & Müllert, 1979) with standards of empirical social science.
Veranstaltungszeit: Donnerstags, 16:00 s.t. – 18:00 (ab 21.10.2021)
Einschreibeschlüssel: folgt
Loïc Masson auf der Fakultätshomepage
In diesem Jahr endet die seit 2021 tagende Weltsynode mit dem Thema „Für eine synodale Kirche“. Dabei handelte es sich zum ersten Mal in der Kirchengeschichte um eine Synode, an der jede und jeder zur Teilnahme aufgerufen war. Synoden und Konzilien sind allerdings schon seit der Spätantike zentrale Foren zur Diskussion über theologische und strukturelle Elemente der christlichen Kirche Europas. Als bekanntestes Konzil des Mittelalters darf wohl das Konzil von Konstanz (1414-1418) gelten, dass auch in den populären Medien immer wieder präsent ist.
Wir versuchen dagegen die sogenannten ökumenischen Konzilien von Nicäa (325) bis zum V. Laterankonzil (1512-1517) vergleichend zu betrachten. Entsprechend wäre zu fragen: Vor welchem Hintergrund kamen die Konzilien zustande? Über was und in welcher Atmosphäre wurde debattiert? Lassen sich Unterschiede oder Entwicklungen im Laufe der Zeit nachvollziehen? Ziel des Seminars soll es sein, nicht einer Epoche, sondern einem Konzept über einen gewissen Zeitraum zu folgen und so exemplarisch eine größere Entwicklungslinie herauszuarbeiten. Zudem sollen grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der mittelalterlichen Geschichte sowie der wissenschaftlichen Propädeutik vermittelt werden.Lecturers: Prof. Ralf Elsas (elsas@lmu.de)
Valentin Luz (luz@lmu.de)
Mareike Worch (worch@lmu.de)
Language: English
Credits: The grade is based on an entrance exam and a presentation, 6 ECTS
Typical Class Size: 20 participants
Presentation:
tbaDate & Time:
Einschreibeschlüssel: LMU
Auf die Frage des ZEIT-Journalisten, ob es „auch expliziten Trash im Rahmen des Welterbes“ gebe, antwortete der Ethnologe Christoph Brumann: „Das muss jetzt nicht ins Interview, aber man kann sich schon fragen, ob jedes Barockschloss, das seit alter Zeit auf der Liste steht, wirklich den Status von Versailles hat“ ("Der Drang nach Welterbe ist weltweit ungebrochen", Zeit Online, 26. Juli 2021, https://www.zeit.de/kultur/kunst/2021-07/unesco-welterbe-mathildenhoehe-kurbaeder-ethnologie-christoph-brumann-interview). Sind alle Schlösser in Europa letztlich unbedeutende Kopien und Abwandlungen von Versailles? Diese in der Allgemeinheit weitverbreitete, bis hin zu Intellektuellen und Experten weit verbreitete Meinung und in der älteren Forschung vertretene Position verkennt die Komplexität der Kunst in der höfischen Gesellschaft in Europa grundlegend. Die Kunst der höfischen Innendekoration ist für die Frühen Neuzeit in Europa kennzeichnend, hat jedoch im Vergleich zum Tafelbild nicht eine vergleichbare Aufmerksamkeit erhalten. Viele Missverständnisse und Gemeinplätze sind auf dieses Forschungsdefizite zurückzuführen. Das Zusammenspiel von Architektur, Malerei, Skulptur, Stuck, Holzarbeiten und Möbel in der höfischen Innendekoration, die wechselnden Wirkungsabsichten dieses fälschlich oft als ‚Gesamtkunstwerk‘ apostrophierten Zusammenspiels sollen untersucht werden. Die komplexen Wechselwirkungen zwischen dem Königreich Frankreich und dem Alten Reich werden im Seminar an exemplarischen Beispielen diskutiert werden. Neben Referaten wird ein gemeinsames Lektürepensum, das in den Stunden auch durch Diskussionen eingefangen wird, absolviert. Die Austauschprozesse zwischen den Schlössern auf beiden Seiten des Rheins auf der Ebene der Auftraggeber- und Künstlerreisen, graphischer Vorlagen und Reiseberichten sollen differenziert in den Blick kommen. Dabei sollen auch weibliche Auftraggeber, Mätressen und Favoriten immer wieder in den Blick kommen. Fragen von Rang; Funktion und Zeremoniell sollen bei der Betrachtung des Austausches gegenüber stilistischen Fragen bevorzugt werden. Geplant ist eine einwöchige Exkursion nach Paris direkt im Anschluss an das Ende des Wintersemesters. Das Seminar wird in Präsenz durchgeführt. Voraussetzung für das Seminar ist die Bereitschaft zur Lektüre und zur Einarbeitung, Französischkenntnisse sind von Vorteil. Das Seminars ist für die Findung von Themen für Bachelor- und Masterarbeiten geeignet. Das Seminar steht im Zusammenhang zum Forschungsprojekt "Corpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland" der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und des DFG/ANR-Projekts "Eine Verflechtungsgeschichte der Deckenmalerei in Deutschland und Frankreich". Dei Teilnahme am Seminar ermöglicht einen Einblick in die Methoden und Werkzeuge der digitale Erforschung von Kulturerbe.
Zur Einführung werden folgende Videos empfohlen:
BR-Alpha zur Langzeitforschung
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/programmkalender/sendung-3239380.html
Matteo Burioni beim 60. Geburtstag des Leibniz-Rechenzentrums:
Zur Einführung empfohlen werden meine Vorlesungen:
Aufzeichnung der Vorlesung "Tiepolo" (WiSe 2019/2020)
Aufzeichnung der Vorlesung "Deckenmalerei in Europa 1450-1800" (WiSe 2020/2021)
19.10. Einführung/Gemeinsame Lektüre
Lektüre: Stollberg-Rilinger 2013, 7-110; Elias 1969, S. 68-97; Grave 2015, S. 9-75 u. 253-273; Sjöström 1978, S. 7-79.
26.10. Die höfische Gesellschaft und die Innenraumdekoration/3D-Modelle als Werkzeuge
2.11. Die Schule von Mantua und die höfische Innendekoration in Frankreich und Deutschland/Datenbanken und Graphdatenbanken
9.11. Die Münchner Residenz unter Herzog und Kurfürst Maximilian I.
Referate: 1. Baugeschichte, 2. Peter Candid, Deckenmalerei, 3. Peter Candid, Teppiche
16.11. Henri IV. und die höfische Innendekoration
Referate: 1. Louvre 2. Fontainebleau
23.11. Maria de‘ Medici und der Palais du Luxembourg
Referate: 1. Rubens Maria de Medici Zyklus 2. Baugeschichte des Palais und Jardin du Luxembourg
30.11. Henriette Adelaide in München
Referate: 1. Die Residenz unter Henriette Adelaide, 2. Nympenburg unter Henriette Adelaide
7.12. Die Repräsentation der Kardinäle in Frankreich
Referate:
1. Die Architektur des Stadtpalais im Paris 2. Palais Cardinal für
Richelieu, Philipp de Champagne, 3. Galerie Mazarine, Romanelli
14.12. Fürstbischöfe im Alten Reich
Referate: 1. Lothar Franz von Schönborn im Kaisersaal des Bamberger Residenz, 2. Clemens August in Schloss Brühl
21.12. Lustschlösser im Alten Reich
Referate: 1. Hoflössnitz in Radebeul, 2. Schloss Lustheim in Schleissheim
11.1. Lustschlösser in Frankreich
Referate: 1. Pavillon des Sceaux für Courbet, 2. Schloss Vaux für Fouquet
18.1. Das Modell Versailles
Referate:
1. Versailles, ein Forschungsüberblick, 2. Die Architektur des
Schlosses von Versailles, 3. Die Innendekoration des Spiegelsaals in
Versailles
25.1. Die Paradeschlafgemächer für August den Starken in Dresden
Referate:
1. Architektur der Dresdner Residenz, 2. Die Paradeschlafgemächer und
Louis de Silvestre, 3. Der Französische Pavillon des Zwingers, 4. Die
höfische Repräsentation von Christiane Eberhardine von
Brandenburg-Bayreuth
25.1. Schloss Rheinsberg und Friedrich II.
Referate: 1. Der Spiegelsaal von Schloss Rheinsberg, 2. Schloss Meseberg und die Favoriten des Prinzen Heinrich und Friedrichs
1.2. Die Genese einer neuen Form der Deckenmalerei in Frankreich
Referate
1. Banque de France, Lemoyne und Pellegrini, 2. Lemoyne in Salon
d’Hercule in Versailles, 3. Hotel d’Argenson, Antoine Coypel
8.2. Die Genese einer neuen Form der Deckenmalerei im Alten Reich
Referate: 1. Louis de Silvestre im Dresden, 2. Jacopo Amigoni in Schleißheim, 3. Tiepolo in Würzburg

During the last decade the availability of large amounts of data and the
strong increase in computing power allowed a renaissance of neural
networks and advanced planning techniques for independent agents.
Whereas the area of deep learning extended well established neural
network technology to allow a whole new level of data transformation,
modern reinforcement learning techniques yield the artificial backbone
for intelligent assistant systems and autonomous vehicles. The course
starts with an introduction to neural networks and explains the
developments that led to deep architectures. Furthermore, the course
gives an introduction to advanced planning techniques and how they can
be trained using deep neural networks and other machine learning
technologies.
Veranstaltungszeit: Do., 18–20 Uhr c.t.
Einschreibeschlüssel: folgt
Dr. Katrin Bayerle auf der Fakultätshomepage
Prof. Dr. Hans-Georg Hermann auf der Fakultätshomepage
Ausgangspunkt dieser Übung ist die Debatte um den Historiker Achille Mbembe, der zu Beginn des Jahres 2020 mit dem Vorwurf des Antisemitismus und einer Relativierung des Holocausts konfrontiert worden war. Obwohl die Debatte um Mbembe im Jahr 2020 an den Historikerstreit von 1986/87 erinnert, ist sie keine bloße Wiederholung. Dennoch beschäftigen sich beide Debatten mit der Frage nach der Singularität der Shoah und der Vergleichbarkeit von Menschheitsverbrechen, weshalb sich die Frage nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden der beiden historisch spezifischen Debatten stellt. Darüber hinaus spiegelt sich in der Debatte 2020 jedoch auch grundsätzlich eine methodische Diskussion über die Themen, Theorien und Perspektiven postkolonialer Studien wider. Ausgehend von der Debatte um Mbembe will die Übung also die Gestaltung multiperspektivischer Erinnerung und postkoloniale Positionen für eine kritische Geschichtsschreibung ausloten.
Anforderungen:
1. Prüfungsleistung: Essay (8.000-15.000 Zeichen (B.A.) bzw. 12.000-20.000 Zeichen (M.A.)); Abgabetermin: 28.02.2021; Abgabe per E-Mail an robert.kramm [at] lrz.uni-muenchen.de.
2. Lektüre und Diskussionsbeteiligung;
3. Bitte reichen Sie jede Woche eine Frage und/oder kurzen Kommentar zum jeweiligen Text in der Semesterwoche bis Dienstag (12:00 mittags) (also vor der entsprechenden Sitzung am Mittwoch) per E-mail an robert.kramm [at] lrz.uni-muenchen.de ein. Ihre Fragen und Kommentare dienen mir zur Orientierung und erlauben mir, genauer auf bestimmte Sachverhalte, Argumente und konkrete Textstellen einzugehen. Zudem kann ich dadurch einfacher Ihre Beiträge in der jeweiligen Sitzung aufgreifen und in die Diskussion miteinbeziehen.
Verbindliche Rückmeldung zur Prüfung in modularisierten Studiengängen zwischen 11. und 22. Januar 2021.
Sprechstunde über Zoom nach Anmeldung per E-mail (robert.kramm [at] lrz.uni-muenchen.de).
Veranstaltungszeit: Mo., 10–12 Uhr c.t. (ab 18.10.2021)
Blockveranstaltung:
Mi., 09–18 Uhr c.t. (15.12.2021 - 17.12.2022)
Einschreibeschlüssel: folgt
Veranstaltungszeit: Blockveranstaltung
Zeit wird noch bekannt gegeben
Einschreibeschlüssel: folgt
Prof. Dr. Jens Kersten auf der Fakultätshomepage
Hassreden und politische Reden können weitreichende Folgen haben. So gehen Experten davon aus, dass die Rede von Donald Trump vom 6. Januar 2021 entscheidend dazu beigetragen hat, dass dessen Anhänger später am Tag das Kapitol in Washington stürmten. Ähnlich hatte die Propaganda gegen die jüdische Bevölkerung in Nazi-Deutschland zum Ziel, antisemitische Einstellungen zu befördern, welche zu zunehmender Diskriminierung und Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung und letztlich zu deren Völkermord geführt haben. In der analytischen Sprachphilosophie hat dies in den letzten 20 Jahren zur Beschäftigung mit der Frage geführt, wie politische Reden und Hassreden diese Veränderungen im Denken, Fühlen und Tun von Menschen herbeiführen. Ziel dieses Seminars ist es, die Studierenden anhand der Lektüre von zentralen Arbeiten in die aktuelle Diskussion dieser Frage einzuführen. Dabei sollen die Studierenden lernen, sich mit den wichtigsten Positionen kritisch auseinanderzusetzen.

Veranstaltungszeit: Blockveranstaltung
Montag, 13:00 s.t. – 18:30 s.t. am 07.02.2022
Dienstag, 13:00 s.t. – 18:30 am 8.02.2022
Mittwoch, 13:00 s.t. – 18:30 am 09.02.2022
Donnerstag, 13:00 s.t. – 18:30 am 10.02.2022
Freitag, 13:00 s.t. – 18:30 am 11.02.2022
Einschreibeschlüssel: folgt
Dr. jur. Lihang He auf der Fakultätshomepage
Die Anmeldung zur Klausureinsicht ist im Zeitraum vom 27.9. bis zum 8.10. möglich. Nähere Informationen finden Sie rechtzeitig hier: https://www.bwl.uni-muenchen.de/index.html
Den Kurs Einkommensteuerrecht von Frau Dr. Johanna Stark finden Sie nun im Wintersemester 2021/22 unter https://moodle.lmu.de/course/view.php?id=11270.
This seminar is targeted at both Master of Science and Master of Business Research students with a broad interest in organization topics, especially with an empirical approach. The seminar will provide insights on scientific methods and the process of research, focusing on applications in organization design and strategic organization research. After lecture sessions, students will work on a short proposal for a research project.
The seminar has three goals in the broad field of empirical organizations. First, students will learn to critically read academic papers, enabling them to assess causal empirical arguments. Second, they will learn how to develop research questions and how to make a contribution. Finally, they will get familiar with relevant research methods and will be able to develop a sound empirical research design to rigorously answer their research questions. We expect the seminar to be useful as a preparation for a master thesis or a PhD paper in the broad field of organization and its intersections with innovation or strategy research.
This seminar is limited to Master of Science and Master of Business Research students. The number of participants is limited to 10. To apply, please send a CV and a recent transcript to Tim Meyer, Ph.D. (tim.meyer@lmu.de) by 06.10.21. We will get back with a decision e-mail regarding your participation by 11.10.21.
Veranstaltungszeit: Di., 16–19 Uhr c.t. (ab 19.10.2021), Geschw.-Scholl-Pl. 1 (A) - A 021
Blockveranstaltung:
Kursbeginn: Donnerstag, 15.4.2021
Zum Einschreibeschlüssel (nur für Angehörige der LMU)
Dr. Maria Mesch auf der Fakultätshomepage
Zenger, Florian auf der Fakultätshomepage
Veranstaltungszeit: Blockveranstaltung
Montag, 10:00 s.t. – 15:00 s.t. am 14.02.2022
Dienstag, 10:00 s.t. – 15:00 am 15.02.2022
Mittwoch, 10:00 s.t. – 15:00 am 16.02.2022
Donnerstag, 10:00 s.t. – 15:00 am 17.02.2022
Freitag, 10:00 s.t. – 12:00 am 18.02.2022
Einschreibeschlüssel: folgt
Marina Bouscant auf der Fakultätshomepage
Veranstaltungszeit: Blockveranstaltung
Montag, 10:00 s.t. – 15:00 s.t. am 21.02.2022
Dienstag, 10:00 s.t. – 15:00 am 22.02.2022
Mittwoch, 10:00 s.t. – 15:00 am 23.02.2022
Donnerstag, 10:00 s.t. – 15:00 am 24.02.2022
Freitag, 10:00 s.t. – 12:00 am 25.02.2022
Einschreibeschlüssel: folgt
Marina Bouscant auf der Fakultätshomepage
Die Vorlesung Funktionentheorie (engl. complex analysis) behandelt Funktionen einer komplexen Variable. Zentrale Themen sind holomorphe und meromorphe Funktionen, Laurent-Reihen, der Residuensatz und der cauchysche Integralsatz.
Benutzen Sie zum Einschreiben den passenden Schlüssel je nach Studiengang und Prüfungsordnung:Herzlich Willkommen im Geotope-Kurs (Kartierung und/oder einzelne Geländetage). Der Schlüssel zur Selbsteinschreibung lautet "Geologie". Der Kurs ist semesterbegleitend und findet per ZOOM jeweils Montags um 16:15 Uhr (außer an Feiertagen) statt. Teilnehmer*innen wählen ihre nächsten Geotopbesuche aus, berichten über Ihre Geotopbesuche durch Kurzpräsentationen, analysieren und interpretieren gemeinsam einzelne Fotos geologischer Aufschlüße, stellen Fragen, erhalten Tipps zur Erstellung von Skizzen und Berichten, usw.. Das Seminar dient ebenso der weiteren Planung und zur Diskussion der geologischen Vorkommnisse. Wir arbeiten mit GOOGLE EARTH und der Geotoprechercheseite des Landesamtes für Umwelt.
gez. Anke Friedrich (Stand November 2021, April 2024).
Ausgehend von einer inzwischen gängigen Taxonomie, die zwischen dem klassischen Theismus, dem personalen Theismus und Variationen eines Non-Standard-Theismus (mit durchaus weiter zu unterscheidenden Konzeptionen von Transzendenz und ultimativer Wirklichkeit) differenziert, geht die Lehrveranstaltung den Unterschieden, aber auch den Überlappungen dieser verschiedenen Gotteskonzeptionen nach, analysiert auf einer meta-theologischen Ebene die Bedingungen ihrer Angemessenheit und erkundet ihre Relevanz und ihre Ausdrucksformen in den religiösen und mystischen Traditionen verschiedener Weltreligionen. Dabei setzt der in der Vorlesung unternommene komparativ-theologische Versuch bei dem Gedanken ein, dass es in begrifflicher Hinsicht nur wenige, motivisch sich auch in unterschiedlichen religiösen Traditionen durchhaltende Grundoptionen gibt, das Absolute zu denken. Geleitet ist der Ansatzpunkt der Vorlesung auch von der Frage, ob das christliche Gottesbild die angedeuteten unterschiedlichen Grundoptionen konstruktiv in den Gottesbegriff aufnehmen kann und wie sich gegenwärtige theologische Herausforderungen in den verschiedenen Überzeugungstraditionen der Religionen spiegeln lassen. |
Grids und Clouds stellen unterschiedliche Ausprägungen eines verteilten Informatikparadigmas dar, durch das unter Ausnutzung von geographisch und administrativ verteilten Systemen im Bedarfsfall ein Pool von Ressourcen und abstrakten, virtualisierten und dynamisch-skalierbaren Services (z. B. Rechenleistung, Speicherkapazität, Plattformen, Visualisierung) über das Internet bereitgestellt wird.
In dieser Vorlesung (und den begleitenden Übungen) werden die Grids und Clouds zu Grunde liegenden Fragestellungen und Technologien vorgestellt und praktisch angewandt. Nach einer ausführlichen Motivation werden zunächst grundlegende verteilte Systemmodelle und Basistechnologien betrachtet. Darauf aufbauend werden folgende Themen behandelt: Cloud-Architekturen, Cloud-Programmierung und Software-Umgebungen (Workflows, MapReduce, Spark, Google Cloud Dataflow, Amazon AWS, Data Lakes, etc.), Virtuelle Organisationen, Grid Computing-Umgebungen, Resource Management, Data Management, Ubiquitous Computing mit Clouds und im Internet of Things, Grids of Clouds, Clouds of Grids.
Abschließend werden spezielle Fragestellungen zu Realzeitaspekten, wie sie zum Beispiel im Urgent Computing auftreten, und neue Trends behandelt.
Die Vorlesung richtet sich vornehmlich an Master-Studenten, die sich mit neueren Entwicklungen im verteilten Hochleistungsrechnen (Systemarchitektur, Programmierparadigmen, Leistungseffizienz, Energieeffizienz) vertraut machen wollen.
Der Relevanz des Themas wird durch Gastbeiträge externer Experten Rechnung zu tragen. Diese Vorträge werden teilweise in englischer Sprache gehalten.

Anhand ausgewählter Literatur soll in diesem Grundkurs in die Grundlagen der theologischen Anthropologie eingeführt werden. Neben der theologischen Bestimmung des Menschen unter dem Dual von Geschöpf und Sünder, sollen auch Grundzüge philosophischer Anthropologie behandelt werden und neuere Debatten und Diskurse (u.a. Frage von Sex und Gender in theologischer Perspektive, Wissenschaftliche Erkenntnisse z.B. zur Willensfreiheit) zur Sprache kommen.
Die Veranstaltung behandelt Pflichtstoff des SPB 10 und im ersten und letzten Teil des SPB 5. Sie verbindet verschiedene Formate: Videokonferenzen, Skript, Einführungsvideos, Fallmaterial. Zum Zeitplan und zur Gliederung vgl. Hinweise zur Vorlesung.
Arbeitsmaterial: SGB (beck-Texte im dtv) 50. Aufl. 2021.
Veranstaltungszeit: Di., 16–18 Uhr c.t. (vgl. Vorlesungsplan)Die Anmeldung ist vom 11. bis zum 26.10. (NEU! verlängert) um 8:00 Uhr freigeschaltet. Einschreibeschlüssel: Sozialversicherung
(!) Hinweis: Die erste Vorlesung findet am Dienstag, den 19.10., um 16.00 ct vor Ort im Hörsaal B 006 statt. Es gelten die Hygieneregeln der LMU, d.h. voraussichtliche Maskenpflicht am Platz. Eine Videoübertragung erfolgt nicht. Der Inhalt und Aufbau der Vorlesung sowie der prüfungsrelevante Stoff werden in der ersten Veranstaltung näher erläutert.

In diesem methodisch orientierten Kurs lernen und vertiefen Sie sedimentäre Gesteinsabfolgen systematisch im Gelände aufzunehmen, darzustellen und paläogeographisch sowie regionalgeologisch zu interpretieren.
Veranstaltungsnummer: 20440

Willkommen zur interaktiven Lerneinheit Mensch-Maschine-Interaktion. Sie ersetzt den Vorlesungsteil, der normalerweise an der LMU stattgefunden hätte. Hier müsst Ihr Euch erstmal selbst einschreiben, und zwar mit dem Schlüssel, den Ihr bei der Einladung bekommen habt.
Throughout his career, Thomas Hylland Eriksen has used his anthropological lens to shed light on some of the key questions of our time. He has used the toolkit of ethnographic investigations to discuss ethnicity, nationalism, multiculturalism, globalisation, and climate change. Apart from this, he has also provided some memorable introductions to our discipline and insisted on the need for anthropologists to engage with the public sphere. He has argued that the valuable and rich ethnographic analyses produced in our discipline should play a part in wider debates. His body of work shows a particular style of intellectual involvement with complex problems. In his native Norway, he is a well-known public intellectual. Furthermore, from his vantage point in Scandinavia, he scrutinises the history of our discipline’s main founding schools classified according to the nation states that housed them: the United Kingdom, France, Germany, and the United States. In this course, we will read some of Eriksen’s texts to explore how he has combined detailed ethnographic analyses with profound examination of planetary situations.
Wintersemester 2021-2022Veranstaltungszeit: Do., 10–12 Uhr c.t. (ab 19.10.2021)
Einschreibeschlüssel: folgt
Prof. Dr. Harald Hess auf der Fakultätshomepage
Intercultural differences have a great influence on management decisions and outcomes. For managers, intercultural competence is one of the most important requirements for working successfully in a global environment. This course enables students to identify and understand intercultural challenges, sharpens their awareness of the importance of cultural aspects and provides them with skills to solve intercultural dilemmas and tensions. In this module, students will analyze and understand modern and well-established theories and methods of intercultural management and will be able to apply these to various practical problems of global managers. They will get a comprehensive overview of the current state of intercultural management research and will be able to evaluate theoretical and empirical studies in this field.
The course includes a weekly lecture (theory) and two application sessions.
The course will be held virtual via Zoom (link below).
Lecture:
Thuesday 19.10.2021-8.02.2022, 10-12pm
#1 Session: 08.11.2021,
17-20h
#2 Session: 24.01.2022, 17-20h
Veranstaltungszeit: Freitag, 16:00 c.t. – 18:00 (ab 22.10.2021)
Einschreibeschlüssel: folgt
Susan Byron auf der Fakultätshomepage
Zielgruppe
Die Themeninhalte des Seminars umfassen die Analyse des sich räumlich und zeitlich ändernden Reiseverhaltens sowie die Untersuchung der mit diesen Veränderungen in Zusammenhang stehenden Entwicklungen. Übergeordnet wird die Fragestellung untersucht, inwieweit sich der Stellenwert des Reisens im Konsumverhalten der Menschen in den letzten 50 Jahren gewandelt hat. Dazu kann beispielsweise der Einfluss von Krisen auf die individuelle Bedeutungszuweisung des Reisens untersucht werden, indem etwa das sich ändernde Reiseverhalten mit sich während der letzten Finanzkrise verändernden sozioökonomischen Umständen in Bezug gesetzt wird. Weiterhin können gewisse Touristengruppen wie etwa Deutschland-Urlauber fokussiert und unter Einbeziehung der letzten Jahrzehnte charakterisiert werden.
Veranstaltungszeit: Blockveranstaltung
Montag, 09:00 s.t. – 15:00 s.t. am 14.03.2022
Dienstag, 09:00 s.t. – 15:00 am 15.03.2022
Mittwoch, 09:00 s.t. – 15:00 am 16.03.2022
Donnerstag, 09:00 s.t. – 15:00 am 17.03.2022
Freitag, 09:00 s.t. – 15:00 am 18.03.2022
Einschreibeschlüssel: folgt
Veranstaltungszeit: Blockveranstaltung
Montag, 09:00 s.t. – 15:00 s.t. am 28.03.2022
Dienstag, 09:00 s.t. – 15:00 am 29.03.2022
Mittwoch, 09:00 s.t. – 15:00 am 30.03.2022
Donnerstag, 09:00 s.t. – 15:00 am 31.03.2022
Freitag, 09:00 s.t. – 15:00 am 01.04.2022
Einschreibeschlüssel: folgt
Veranstaltungszeit: Montags, 18:00 c.t. – 20:30 c.t. (ab 18.10.2021)
Einschreibeschlüssel: folgt
David Casey, LLB (Hons) auf der Fakultätshomepage
Veranstaltungszeit: Blockveranstaltung
Freitag, 09:00 s.t. – 15:00 s.t. am 25.03.2022
Montag, 08:30 s.t. – 13:30 am 11.04.2022
Dienstag, 08:30 s.t. – 13:30 am 12.04.2022
Mittwoch, 08:30 s.t. – 13:30 am 13.04.2022
Donnerstag, 08:30 s.t. – 13:30 am 14.04.2022
Einschreibeschlüssel: folgt
Melanie Unseld auf der Fakultätshomepage
Veranstaltungszeit: Blockveranstaltung
Montag, 08:30 s.t. – 13:30 s.t. am 04.04.2022
Dienstag, 08:30 s.t. – 13:30 am 05.04.2022
Mittwoch, 08:30 s.t. – 13:30 am 06.04.2022
Donnerstag, 08:30 s.t. – 13:30 am 07.04.2022
Freitag, 08:30 s.t. – 13:30 am 08.04.2022
Einschreibeschlüssel: folgt
This course introduces students to the substantive law of crimes in the U.S. The primary emphasis is on doctrines applicable to most crimes, such as actus reus, mens rea and the defenses of insanity, intoxication, mistake, duress, necessity, and self-defense. Specific crimes and theories of punishment will also be discussed in the context of selected court opinions and the Model Penal Code. This course will also place criminal law in a contemporary context by critically analyzing social justice issues and other themes related to criminal justice system reform.
Veranstaltungszeit: Blockveranstaltung | Einschreibeschlüssel: folgt | Lauren Tonti auf der Fakultätshomepage

Veranstaltungszeit: Blockveranstaltung
Montag, 09:00 s.t. – 15:00 s.t. am 28.02.2022
Dienstag, 09:00 s.t. – 15:00 am 01.03.2022
Mittwoch, 09:00 s.t. – 15:00 am 02.03.2022
Donnerstag, 09:00 s.t. – 15:00 am 03.03.2022
Freitag, 09:00 s.t. – 15:00 am 04.03.2022
Einschreibeschlüssel: folgt
Lauren Tonti auf der Fakultätshomepage
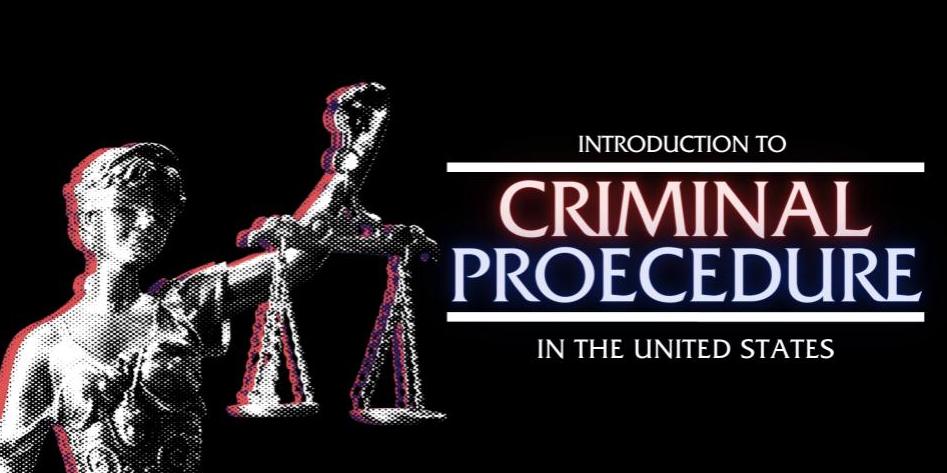
Japan remains one of the most powerful and dynamic economies of the world. The country’s economic catch-up and over-taking in key industries –within an exceptionally short period of time the Japanese economy managed to bridge the gap between ‘an almost developing’ country to a leading industrialized nation – has evoked a wide spectrum of reactions: Awe, assumptions of conspiracy or even economic warfare. Regardless of the juxtaposing notions of ‘learning from Japan’ or ‘confronting Japan’, the common denominator is the need to understand the Japanese economy and business environment. In the wake of the collapse of the speculative financial bubble, Japan has witnessed the longest recession period in the post-war era. "The lost decade" has replaced the ‘Japan as No1’ syndrome and until recently, the image has been that of a tumbling giant rather than that of vibrant economy. The Japanese economy is, however, on its way to recover. Economic indicators suggest nothing less than successful reforms and revival. Amid rapid internationalization and the prognosticated advent of a new global system, the Japanese economy once more underlines its flexibility to adjust to new challenges. It is the juncture of continuity and change of the economic system on which this module is focusing. Knowledge about Japan is essential to make informed corporate decisions.
This module equips students with a comprehensive introduction of the Japanese economy. Students will be able to understand and evaluate theoretical and empirical studies in this field. They will not only learn about Japan’s role in the global economy and about Japan’s key industries and companies, but will also be exposed to well-established concepts and theories of business management and will learn to understand and apply them to the Japanese context. The module covers important functions of management such as intercultural differences, managing international business activities, consumer behavior, marketing, and human resource management.
If you require additional details, please contact Prof. Nikolaus Seitz (seitz@bwl.lmu.de) or Jane Khanizadeh (khanizadeh@bwl.lmu.de)
Tuedday 14:00-16:00, session starts October 19th, 2021
Überblick:
Auch die Geschichtswissenschaft steht nicht außerhalb der Geschichte, sondern spiegelt in jeder Epoche gesellschaftliche, religiöse und politische Tendenzen ihrer Zeit wider. In der Übung wird auf der Grundlage von Primärtexten die Geschichte der jüdischen Geschichtsschreibung vom späten 18. bis ins 21. Jahrhundert rekonstruiert und dabei die Vielfalt an Strömungen und Ansätzen herausgearbeitet. Dabei wird offenbar, dass es nicht „die“ jüdische Geschichte, sondern eine Vielzahl an jüdischen Geschichten gibt, die alle nebeneinanderstehen und jeweils bestimmte Aspekte der jüdischen Kultur hervorheben oder ausblenden. Heutige Historiker:innen müssen sich in diesem Geflecht an Narrativen zurechtfinden und das eigene Fach konsequent historisieren, um selbst kritische Geschichtswissenschaft betreiben zu können.
Erwartet wird neben der aktiven Teilnahme eine Textpräsentation mit Thesenpapier. Bestandteil der Übung ist eine Exkursion ins Levi Strauss Museum nach Buttenheim, die sich der Geschichte des Landjudentums widmet.
Literatur:
Philipp Lenhard: “Jüdische Geschichtsschreibung,” in Christina von Braun, Micha Brumlik (Hg.): Handbuch Jüdische Studien. 2. Auflage (Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2021), 307-322.
Quellenband: Michael Brenner u.a. (Hg.): Jüdische Geschichte lesen. Texte der jüdischen Geschichtsschreibung im 19. und 20. Jahrhundert (München: C.H. Beck, 2003).
Kursanforderungen:
Von den Studierenden wird die regelmäßige und aktive Teilnahme am Kurs sowie pünktliches Erscheinen erwartet. Außerdem ist die gründliche Vorbereitung des für die Sitzung vorgesehenen Textes obligatorisch. Jeder Teilnehmer muss ein Impulsreferat von 10-15 Minuten halten, in dem die Hauptthesen eines der Texte pointiert vorgestellt werden. Einzelheiten dazu werden im Kurs bekannt gegeben.
Technische Hilfsmittel:
Laptops und Tablets sind selbstverständlich erlaubt, aber ausschließlich unterrichtsbezogen zu verwenden. Smartphones sind auszuschalten.
Betrug und Täuschung:
Plagiate – also das Vortäuschen eigener Leistungen auf Grundlage der Leistung anderer – jeder Art sind strikt verboten und ziehen immer Konsequenzen nach sich. Das Abschreiben gilt als Täuschungsversuch und hat zur Folge, dass die Prüfungsleistung als nicht bestanden gilt.
Bewertung und Termine:
Nur die oben genannte Prüfungsleistung wird benotet, allerdings geht in diese das Erarbeitete aus dem Unterricht ein. Obligatorisch für alle ist die Prüfungsanmeldung im LSF zwischen dem 30. Juni – 11. Juli 2025.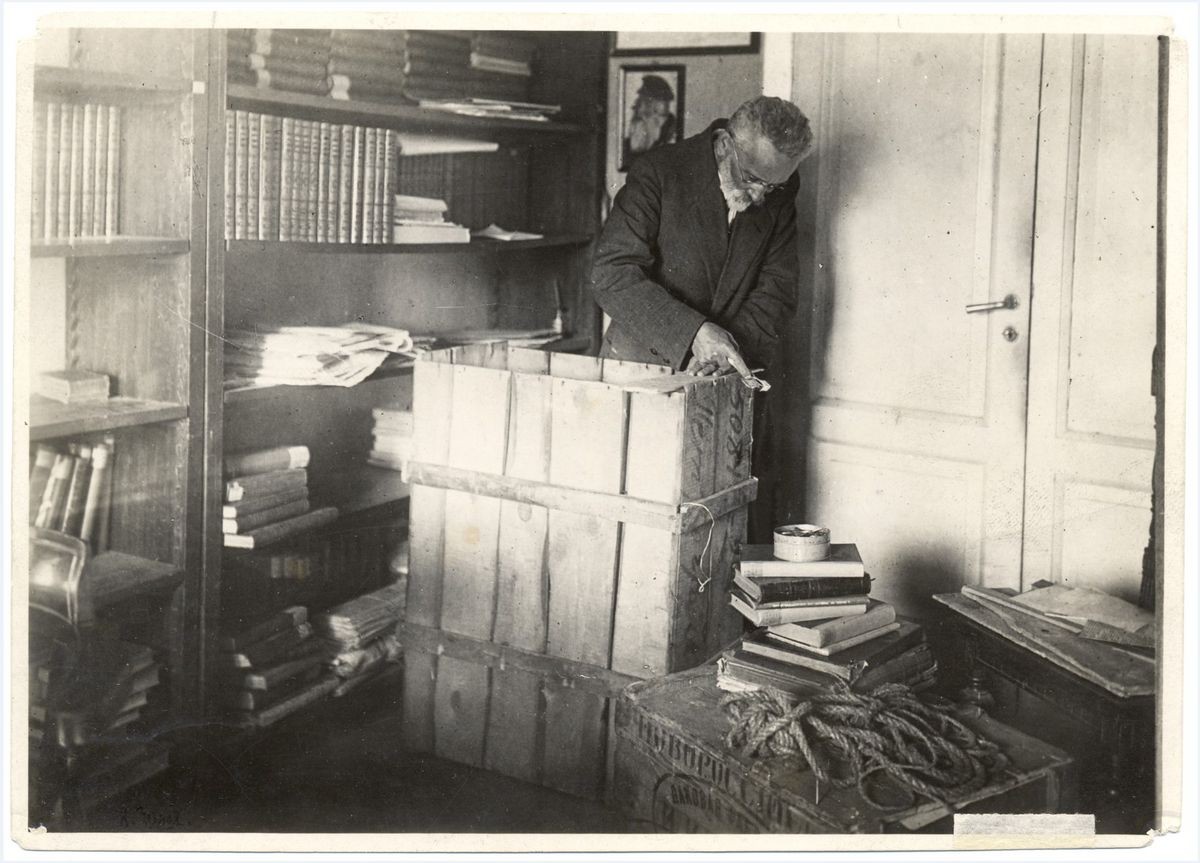
Sie sind in dieses Moodle eingeschrieben, weil Sie eine der folgenden Klausuren schreiben:
Sie sind in diesem Kurs angemeldet, wenn Sie eine der folgenden Klausuren schreiben:
Sie sind in diesem Moodle, wenn Sie sich für eine der folgenden Klausuren angemeldet haben:
- Aufbaumodul BA Romanistik Spanisch nach PStO 2010
- SLK - Spanisch I / Spanisch II / Expresión oral y escrita I - mit Beginn des Spanischstudiums vor WS17/18
Veranstaltungszeit: Blockveranstaltung
Fr., 08–18 Uhr c.t. (07.01.2022)
Einschreibeschlüssel: folgt
Prof. Dr. Ann-Katrin Kaufhold auf der FakultätshomepageVeranstaltungszeit: Blockveranstaltung
Zeit wird noch bekannt gegeben
Einschreibeschlüssel: folgt
Prof. Dr. Reto M. Hilty auf der Fakultätshomepage
Veranstaltungszeit: Dienstags, 10:00 s.t. – 11:30 (ab 28.09.2021)
Einschreibeschlüssel: folgt
Gretchen Liersaph-Turck auf der Fakultätshomepage
Liebe Studierende,
Dieser Kurs wird dieses Jahr online stattfinden. Wir werden zusammen fachwissenschaftliche Themen, die ihr in Form von Referaten der Gruppe vorstellt, diskutieren. Danach werdet ihr unter Anwendung des erworbenen didaktischen Wissens die neu gewonnenen limnologischen Kenntnisse in online Materialien für Schulklassen umsetzen. Diese werden dann hier in moodle hochgeladen und evtl. von Schülern getestet. Im Anschluss wollen wir auch eine Bewertung des online-Auftritts durchführen.
Ziel des Praktikums ist es eine virtuelle Exkursion in die Welt der Limnologie für die Grundschule vorzubereiten.
Ziele und Schwerpunkte: Im Zentrum stehen das genaue Lesen – d.h. die Übersetzung in ein korrektes Deutsch – und die Analyse von Sprache und Inhalt am Beispiel einzelner Gedichte der genannten Autoren. Neben den auf die Form und Inhalt gerichteten Fragen (Gedichtaufbau, Metrik, Thematik) sowie der Frage nach dem Entstehungskontext sollen anhand der Lektüre die wichtigsten Merkmale der römischen subjektiven Liebeselegie bzw. der römischen Lyrik besprochen werden.
Zum Leistungsausweis gehören die gründliche Vorbereitung (mit Benutzung der im Semesterapparat aufgestellten Kommentare) und die regelmäßige Teilnahme sowie das Bestehen der Abschlussklausur. Es gilt Anwesenheitspflicht in der ersten Sitzung des Semesters, in der eine Einführung zur Methode im Lektürekurs sowie zu Autoren, Metrik und literarischer Gattung gegeben wird.
Die Texte der im Programm genannten Autoren (aus den kritischen Ausgaben) sowie die (wissenschaftlichen) Kommentare pro Woche in Moodle eingestellt. Bitte nur diese Texte bzw. Ausgabe benutzen!
Literatur zur Vorbereitung:
Boldrini, S. Prosodie und Metrik der Römer,
übers. von B.W. Häuptli (Stuttgart/Leipzig 1999)
Holzberg, N. Die
römische Liebeselegie. Eine Einführung (Stuttgart 52001).
Mayer, R. Horace. Odes
Book I (Cambridge 2012), Einleitung.
Schmidt, E.A. Catull (Heidelberg
1985)

Universities and colleges are among the oldest institutions in US-American society. They thus partake in the structural and systemic racism that is still a defining element of that society. Recently, there have been efforts to address the historical dimension of this issue in higher education, as well as a strive towards devising strategies of reform and best practice for the present. We will take a look at both these aspects and their connections. This class is part of a BAA Verbundsseminar (together with the Universities of Erlangen and Passau). It will conclude in a joint student conference at Munich Amerikahaus (July 23/24, 2021), with the opportunity for participants to present their work.
Dieses Seminar bietet erstmals einen umfassenden Überblick über den Stand der Forschung und zur Praxis der Mehrsprachigkeits- und Mehrkulturalitätsdidaktik. Die Themen behandeln: Sprachenpolitik (national und EU), Interkomprehension, Erst-, Zweit- und Mehrsprachenerwerb, Tertiärsprachendidaktik, lebensweltliche Vielsprachigkeit, Herkunftssprachen, autochthone Mehrsprachigkeiten, Kompetenzorientierung, interkulturelles Lernen, Translanguaging, Unterricht an mehr- oder vielsprachigen Lerngruppen u.v.a.m.
Fäcke, Christiane; Meißner, Franz-Joseph (Hrsg.) (2019): Handbuch Mehrsprachigkeits- und Mehrkulturalitätsdidaktik. Tübingen: Narr.
Ekinci, Yüksel; Hoffmann, Ludger (Hrsg.) (2021): Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität im Konflikt. München: Unicum.
PRACTICAL COURSE: Students will learn how to generate NGS sequence data and develop trait matrices to test evolutionary and systematic working hypotheses in plant evolutionary biology. They will gain first-hand experience with NGS sequence data handling, phylogenetic tree reconstructions, time divergence estimation analysis, ancestral area reconstruction analysis and trait reconstruction. Students are expected to submit a report in form of a publication summarising and discussing the results generated throughout the practical course. For further details, please see the webpage of the section Systematics, Biodiversity and Evolution of Plants.
SEMINAR: Each student will present and discuss a publication on a phylogenetic reconstruction of a certain plant taxon. Possible subtopics are biogeography, trait evolution, systematics, diversification, coevolution, biotic interactions.
Das Musikvideo gehört zu den revolutionärsten und einflussreichsten Medienformaten der letzten vierzig Jahre. Immer noch ist es fester Bestandteil der Bilderwelten von Pop- und Jugendkultur. Es war lange Zeit das stärkste und teuerste Werbeinstrument der Musikindustrie, Experimentierfeld und Trittbrett für eine neue Generation von Filmregisseuren, Maßstab für technologische und ästhetische Innovationen der Videokunst. Nach dem Niedergang des Musikfernsehens zu Anfang der 2000er Jahre hat das Musikvideo schnell seinen festen Platz auf Internet-Plattformen wie YouTube, Vimeo oder Vevo gefunden.
Dieses Seminar will am Beispiel des Videoclips eine Einführung in die Beschäftigung mit popkulturellen Medien geben. Das Musikvideo soll als Verdichtungspunkt einer Reihe von gestaltenden Disziplinen – Bildende Kunst, Film, Digitale Medien, Musik und Literatur verstanden werden, anhand dessen es möglich wird, jugendspezifische Ästhetik zu diskutieren. Was ist Massenkultur, Kulturindustrie, Subkultur? Wie werden innerhalb der Popkultur künstlerische Qualitätsurteile gefällt, wie werden neue „Trends“ erfunden? Ist innerhalb des Systems „Pop“ Kritik an bestehenden Zuständen möglich, und wenn ja wie?
Darüber hinaus soll verdeutlicht werden, dass das Musikvideo ein – auch oder gerade für die Kunstpädagogik - wirksames Kunstmittel ist, um aktuelle Fragen und Phänomene unserer Gesellschaft zu thematisieren.
Im Mittelpunkt jeder Seminarsitzung steht die Analyse exemplarischer Musikvideos zu verschiedenen Themenschwerpunkten wie z.B. Raum und Zeit, Ton und Bild, Zitate, Gender, Pop und Politik oder Mensch und Maschine. Zu den Aufgaben der Seminarteilnehmer gehören:
Ein Großteil der verwendeten Literatur ist nicht auf Deutsch verfügbar. Die Teilnehmer sollten daher grundsätzlich bereit sein, auch englischsprachige Songtexte und Artikel zu lesen.

The course is a compulsory prerequisite for a specialization in Innovation. It provides foundations for students who wish to specialize in the topics addressed by the Institutes* organizing this introductory master-level course. Successful participation in this class contributes 9 ECTS toward the fulfillment of the requirements of the M.Sc. curriculum. The course also serves as an introductory course to the IMPRS-CI curriculum.

Enrolment key: omsose2025
Credits: 9 ECTS
Format: 4 hours lecture, 2 hours exercise
Target audience: MSc FiMa & Math
Time and Location:
Lectures: Tuesday 14-16 (room B133), Thursday 14-16 (room B045)
Exercise Sessions: Monday 12-14 (room B134)
Modules:
MSc FiMa:
Description:
Optimization is the doctrine for finding the "best" alternative between a set of possible options in terms of a given objective function. The course is devoted to the study of the most widely used optimization methods and their convergence analysis. Throughout the lecture, the students will learn how to select the most suited optimization method for a given problem and to evaluate the expected rate of convergence of the algorithm in that specific scenario. The focus will be continuous optimization, meaning that we will consider problems with continuous variables living in a continuous vector space.
Content:
Paris-Lektüren. Moderne Stadterfahrung in Baudelaires Tableaux parisiens (Les Fleurs du Mal) und in Le Spleen de Paris
Paris steht im Zentrum der poetischen Imagination Charles Baudelaires (1821–1867). In Les Fleurs du Mal (1861) – insbesondere im Zyklus Tableaux parisiens – und in Le Spleen de Paris. Petits poèmes en prose (posthum 1869) wird die moderne Großstadt nicht nur thematisch verhandelt, sondern auch ästhetisch durchdrungen: als Ort der Beschleunigung und Zerstreuung, der Anonymität und des Begehrens, der Schönheit und des Verfalls. „Paris, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts“ (Walter Benjamin) wird bei Baudelaire zum Erfahrungsraum eines allumfassenden, neuartigen Lebensgefühls: Paris fungiert dabei nicht nur als räumliche Kategorie, sondern auch als ein Phänomen, das das dem 19. Jahrhundert inhärente Zeitbewusstsein artikuliert. Die Stadt wird zu einem ästhetischen Resonanzraum einer modernen Poetologie, die eng mit der neuen Stadt- und Zeiterfahrung verflochten ist – einer Poetologie, in der sich Stadtwahrnehmung und Dichtung wechselseitig durchdringen.
Ausgehend von einer Lektüre dieser beiden zentralen Werke Baudelaires als poetische 'Paris-Lektüren' stellt das Seminar folgende Leitfragen in den Mittelpunkt:
Zur Anschaffung wird empfohlen:
Baudelaire, Charles: Les Fleurs du Mal / Die Blumen des Bösen [Reclam zweisprachig, übers. v. Monika Fahrenbach-Wachendorff], Stuttgart 2014.
Baudelaire, Charles: Le spleen de Paris. Petits poème en prose / Pariser Spleen. Kleine Gedichte in Prosa [Reclam zweisprachig, übers. v. Kay Borowsky], Stuttgart 2008.
Zur Lektüre wird empfohlen:
Friedrich, Hugo: Die Struktur der modernen Lyrik. Von Baudelaire bis zur Gegenwart, Hamburg 1956.
Stierle, Karlheinz: Pariser Prismen. Zeichen und Bilder der Stadt, München 2016.
Stierle, Karlheinz: Der Mythos von Paris. Zeichen und Bewußtsein der Stadt, Berlin 2021.
Vorlesung WS 2021/2022
The course content is currently available here.
Veranstaltungszeit: Blockveranstaltung
Montag, 09:30 s.t. – 15:00 s.t. am 14.03.2022
Dienstag, 09:30 s.t. – 15:00 am 15.03.2022
Mittwoch, 09:30 s.t. – 15:00 am 16.03.2022
Donnerstag, 09:30 s.t. – 15:00 am 17.03.2022
Freitag, 09:30 s.t. – 15:00 am 18.03.2022
Einschreibeschlüssel: folgt
Gretchen Liersaph-Turck auf der Fakultätshomepage
Type | Date | Time |
|---|---|---|
| Lecture | starting on the 19th of October 2021 | Tuesday 9:15 - 11:30 am |
| Exercise& Tutorial | starting on the 2nd of November 2021 | Monday 14:15 - 15:45 am |
- The enrollment key is preclin_clin_2122
In letzter Zeit hat das öffentliche Interesse an der Mordserie und ihren politischen Auswirkungen zugenommen.[1] Der Projektkurs will dieses Kapitel des Kalten Kriegs und der Münchner Stadtgeschichte weiter im öffentlichen Bewusstsein verankern. Dafür soll ein digitaler Stadtführer als Smartphone-App und ggf. auch als Website erstellt werden, der die Tatorte und weitere relevante Schauplätze des Exils als Stadtrundgang erschließt. Zu jedem Ort werden Informationen in Form von Text, Bildern und ggf. auch Audio-Dateien zur Verfügung gestellt. Als Quellenmaterialien kommen, soweit zugänglich, zeitgenössische Presseberichte, Polizei- und Gerichtsunterlagen, Geheimdienstquellen (z. B. Open Society Archives Budapest) und Ego-Dokumente in Frage.
Ausgehend von den Kriminalfällen vermittelt der Kurs Einblicke in die breitere Geschichte des osteuropäischen Exils. Der Kurs und die App sollen beleuchten, welche Strukturen und Aktivitäten die Exilanten entwickelten, welche politischen Ziele sie verfolgten und in welchem Verhältnis diese zu den Behörden standen. Neben liberalen Dissidenten und Menschenrechtlern fanden auch ehemalige NS-Kollaborateure in München Zuflucht. Den Studierenden wird daher ein kritischer Umgang mit nationalen Opfernarrativen antikommunistischer Geschichtsschreibung in Osteuropa vermittelt. Außerdem sollen die Verflechtungen mit bundesdeutscher Erinnerungskultur herausgearbeitet werden. Die App soll dadurch einerseits Kriminal- und Geheimdienstgeschichte öffentlichkeitswirksam aufarbeiten, andererseits aber auch Kenntnisse der Verflechtungsgeschichte Münchens mit dem östlichen Europa vermitteln.
[1] Jakob Wetzel, Blutspur durch München. In: Süddeutsche Zeitung, 19.02.2021 (https://www.sueddeutsche.de/muenchen/spione-agenten-anschlaege-blutspur-durch-muenchen-1.5211141). ARD-Dokumentation „Mord in Titos Namen - Geheime Killerkommandos in Deutschland“ (2014), https://www.youtube.com/watch?v=uF9Ak1uleyw.
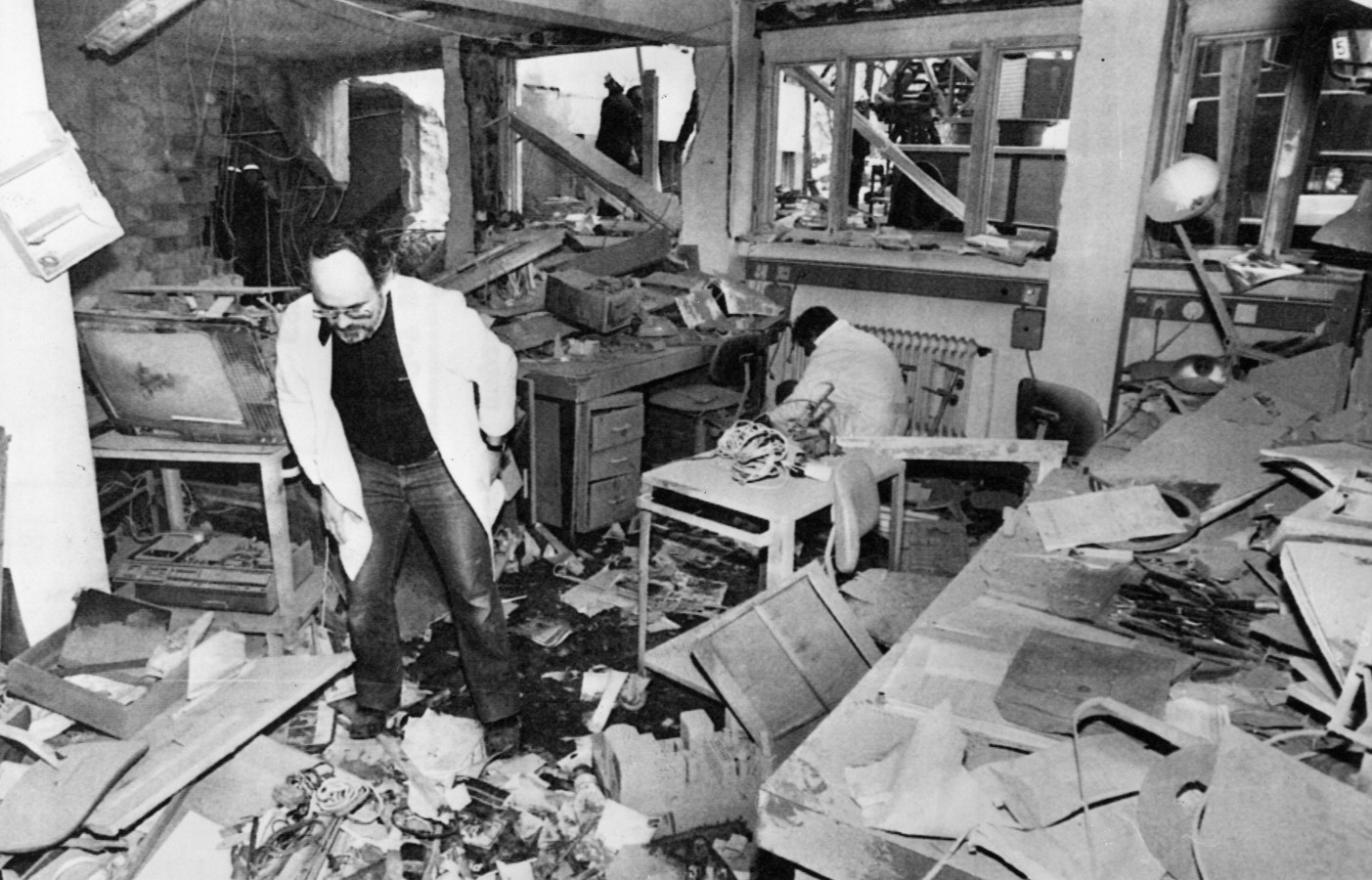
Dozent: Moritz Scherrmann
Sprache: Deutsch
Credits: 6 ECTS
Zyklus: Jedes Semester
Showroom: Ergebnisse der Übung "Qualitätsentwicklung Lehren und Lernen DaF" Sommersemester 2021


Kursbeginn: Dienstag, 13.4.2021
E-Mail-Adresse der Dozentin: bettina.stepanek@jura.uni-muenchen.de
Kursbeginn: Dienstag, 13.4.2021
E-Mail-Adresse der Dozentin: bettina.stepanek@jura.uni-muenchen.de
Kursbeginn: Dienstag, 13.4.2021
Di., 16-18 Uhr c.t.
Dies ist die Moodle-Seite zur Arbeitsgemeinschaft Grundrechte im SoSe 2021 von David Preßlein.
Bei Fragen können Sie sich via E-Mail an presslein@mpisoc.mpg.de an mich wenden.

Kursbeginn: Dienstag, 13.4.2021
E-Mail-Adresse des Dozenten: leonhard.knebel@campus.lmu.de
Diese Arbeitsgemeinschaft könnte ohne Kollision mit den Vorlesungen aller Grundkurse
- sofern dies rechtlich erlaubt ist - wieder in einen hybriden
Präsenzbetrieb wechseln. In diesem Fall würde jedenfalls auch ein
Livestream der Übung angeboten werden.
Kursbeginn: Mittwoch, 14.4.2021
E-Mail-Adresse der Dozentin: carina.stier@jura.uni-muenchen.de
Kursbeginn: Mittwoch, 14.4.2021
Mi., 16-18 Uhr c.t.
Dies ist die Moodle-Seite zur Arbeitsgemeinschaft Grundrechte im SoSe 2021 von David Preßlein.
Bei Fragen können Sie sich via E-Mail an presslein@mpisoc.mpg.de an mich wenden.

Kursbeginn: Montag, 12.4.2021
E-Mail-Adresse des Dozenten: benedikt.riedl@jura.uni-muenchen.de
Kursbeginn: Donnerstag, 15.4.2021
E-Mail-Adresse der Dozentin: Merlin.Reithmann@campus.lmu.de
Diese Arbeitsgemeinschaft könnte ohne Kollision mit den Vorlesungen aller Grundkurse
- sofern dies rechtlich erlaubt ist - wieder in einen hybriden
Präsenzbetrieb wechseln. In diesem Fall würde jedenfalls auch ein
Livestream der Übung angeboten werden.
Kursbeginn: Montag, 12.4.2021
E-Mail-Adresse des Dozenten: M.Aschenbrenner1@campus.lmu.de
Liebe Studierende,
herzlich willkommen zur Arbeitsgemeinschaft Strafrecht I. Diese wird ausschließlich über ZOOM stattfinden. Die erste Einheit beginnt am Montag, 25. Oktober Punkt 18:00 Uhr bis ca. 19:30 Uhr.
Es lohnt sich die Klausur vor jeder Einheit zumindest in Ansätzen zu gliedern. Noch besser: Sie versuchen die Klausur auch auszuformulieren, weil nur dadurch die so wichtige Subsumption (Auswertung des Sachverhalts) eingeübt werden kann.
Zoom-Meeting beitreten
https://lmu-munich.zoom.us/j/99220122492?pwd=dWxwVjFmcHF3YVNyN3B2T3J6ZzY5QT09
Meeting-ID: 992 2012 2492
Kenncode: 265114
- Informationen zum Grundkurs Strafrecht finden Sie hier.
- Informationen zu den Arbeitsgemeinschaften finden Sie hier.
Nutzen Sie gerne die Foren auf Moodle, um Ihre Probleme bei der Lösung der Fälle oder auch allgemeinere Fragen zum Strafrecht mit mir und anderen Studierenden zu klären! Alternativ können Sie mich auch unter meiner Uni-Emailadresse erreichen (Patrick.Voshagen@jura.uni-muenchen.de). Fallen mir selber interessante Argumente oder Lernbeiträge ein, werde ich diese einfach als Textfeld bei den jeweiligen Einheiten posten.
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme.
Bis dann!
Kursbeginn: Dienstag, 13.4.2021
E-Mail-Adresse des Dozenten: patrick.siegle@jura.uni-muenchen.de
Kursbeginn: Dienstag, 13.4.2021
E-Mail-Adresse der Dozentin: ramona.weisenbach@jura.uni-muenchen.de
Kursbeginn: Dienstag, 13.4.2021
E-Mail-Adresse des Dozenten: patrick.voshagen@jura.uni-muenchen.de
Kursbeginn: Freitag, 16.4.2021
E-Mail-Adresse des Dozenten: valentin.sacha@jura.uni-muenchen.de
Kursbeginn: Montag, 12.4.2021
E-Mail-Adresse des Dozenten: lauritz.oellerer@jura.uni-muenchen.de
Kursbeginn: Donnerstag, 15.4.2021
Einschreibeschlüssel: GKOhlySS2021
Kursbeginn: Mittwoch, 14.4.2021
Einschreibeschlüssel: GKOhlySS2021
E-Mail-Adresse des Dozenten: peter.zickgraf@jura.uni-muenchen.de
Kursbeginn: Mittwoch, 14.4.2021
Einschreibeschlüssel: GKOhlySS2021
E-Mail-Adresse des Dozenten: peter.zickgraf@jura.uni-muenchen.de
Kursbeginn: Dienstag, 13.4.2021
Willkommen zum Propädeutikum Programmierung in der Bioinformatik!
Bitte schreibt euch mit dem untenstehenden Einschreibeschlüssel selbst in den Moodle Kurs ein um Teilzunehmen.
Solltet Ihr Probleme beim Anmelden haben, erreicht Ihr uns per Mail an tutorium@bio.ifi.lmu.de .
Einschreibeschlüssel: java
Diese Veranstaltung dient zur Vorbereitung für die mündlichen Modulprüfung in Fundamentaltheologie im Studiengang Magister Theologiae. In diesem Blockkurs wird die Vorlesung "Gottesbilder und Transzendenzvorstellungen in den Religionen" des vohergehenden Wintersemesters behandelt.
Diese Veranstaltung dient zur Vorbereitung für die mündlichen
Modulprüfung in Fundamentaltheologie im Studiengang Magister Theologiae.
In diesem Blockkurs wird die Vorlesung "Offenbarung" des vohergehenden
Wintersemesters behandelt.
Das Prüfungskolloquium II: Offenbarung, dient als Vorbereitung zur Prüfung der gleichnamige
Vorlesungen von Prof. Dr. Schärtl-Trendel.
Dabei wird sowohl
der Vorlesungstoff wiederholt und vertieft, als auch konkrete Übungen
durchgeführt. Außerdem soll diese Veranstaltung den Raum für Fragen und
Diskussionen bieten und inhaltliche wie technische Tipps für die
schriftliche Prüfung, die am 8.02 stattfindet, enthalten.
Die
Veranstaltung richtet sich primär an Studierende, die dieses
Wintersemester zu dieser Vorlesung im Rahmen eines Moduls geprüft
werden. Jeder Teilnehmer der Vorlesung darf jedoch auch am Kolloquium
teilnehmen.
Das Kolloquium wird als online Zoom-Veranstaltung
am Samstag den 30.01.2021 bis Sonntag den 31.01.21 stattfinden. Dabei
werden 5 Zoom-Sitzungen abgehalten.
Voraussetzung für das Kolloquium ist die Teilnahme an der Vorlesung von Prof. Schärtl-Trendel.
Material zur Vorbereitung: Folien und Audios der Vorlesung
Diese Veranstaltung dient zur Vorbereitung für die Prüfung der Vorlesung Glaube und Vernunft in Fundamentaltheologie. Der Kurs steht allen Studenten/innen, die die Vorlesungen besuchen und in diesem Semester zur Vorlesung geprüft werden, offen.
Prof. Jörg Claussen, Tim Meyer, Ph.D., Alexey Rusakov
Quantitative research, i.e. research that uses statistical methods to analyses large datasets, is one of the three pillars of modern science. Similarly, most decisions by firms are nowadays based on information from large datasets gathered and analyzed either internally by a firm or externally by a contracted agency. However, just analyzing data is insufficient in both academia and industry. The second important task for researchers and practitioners is to build a clear and convincing argument why their analysis is important and interesting. This seminar aims at teaching you both skills, analyzing data and theoretical reasoning. These skills are fundamental for writing a final theses and career building. The seminar will provide an overview on structuring theoretical arguments and different quantitative methods, before students apply both to examples in the different sessions. Finally, students will use their acquired knowledge and skills to develop their seminar papers using datasets from the institute and the statistical software STATA.
The seminar will begin with a kickoff session, where the lecturers will introduce students to research, explain theoretical reasoning and recap some empirical methods. This is followed by four 1.5 hour introductory sessions to the statistical software STATA. After six weeks, students will present their preliminary results and afterwards write up their results in a seminar paper. Students will meet regularly with a supervisor over the course of the semester.
"Quellenstudien zur Theatergeschichte" ergänzt die "Ringvorlesung zur europäischen Theatergeschichte bis 1900". In diesem Kurs werden wir uns nach einer allgemeinen Einführung in die Quellenkunde speziell in der Theaterwissenschaft näher mit den Schwerpunkten "Theater der Antike", "Theater der Aufklärung" und "Theater jenseits von Europa bis 1900" auseinander setzen.
"Quellenstudien zur Theatergeschichte" ergänzt die "Ringvorlesung zur europäischen Theatergeschichte bis 1900". In diesem Kurs werden wir uns nach einer allgemeinen Einführung in die Quellenkunde speziell in der Theaterwissenschaft näher mit den Schwerpunkten "Theater des Mittelalters", "Elisabethanisches Theater" und "Theater jenseits von Europa bis 1900" auseinander setzen.
Einschreibeschlüssel für Gasteinschreibung: Nachhaltigkeit
Veranstaltungszeit: Blockveranstaltung
Sa., 09–17 Uhr c.t. (15.01.2022)
So., 09–17 Uhr c.t. (16.01.2022)
Einschreibeschlüssel: folgt
Prof. Dr. Dr. Jan-Hendrik Röver, LL.M. (LSE), FRSA auf der Fakultätshomepage
Kursbeginn: Donnerstag, 15.4.2021
Kurz zusammengefasst geht es in diesem Seminar nicht um Recycling im
ökologischen Sinn, sondern um die vielfältigen Formen der Verwendung von
"Fremdmaterial" in Kunst und Kultur, also Collage, Montage, Readymade,
Sampling, Mashup, Cut-Up etc. Dabei spielt nicht nur die Ästhetik eine
Rolle, sondern auch die sozialen, politischen und mit Blick auf das
Urheberrecht - ethischen und juristischen Aspekte. Was bedeutet die
Vorstellung einer "Remix Culture" für die künstlerische Praxis des
Einzelnen sowie für das Selbstverständnis der Gesellschaft als Ganzes?
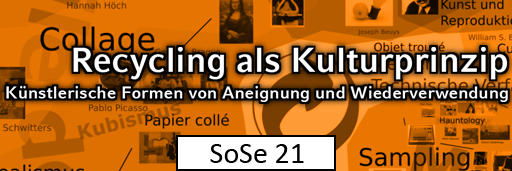
Die Repetitorien geben Ihnen die Möglichkeit, die schriftliche Klausur im Fach Französische Literaturwissenschaft des Staatsexamens für LA Gymnasium bzw. LA Realschule vorzubereiten. Damit zu möglichst vielen Texten des Kanons im Kurs eine Basis gelegt werden kann, wird dieses Repetitorium die Gattung Narrativik fokussieren, während ein weiterer Kurs Lyrik und Drama in den Blick nimmt. Grundlage beider Kurse ist der Prüfungskanon Französische Literaturwissenschaft, dessen narrative Texte Sie in diesem Repetitorium in sorgfältig erarbeiteten Thesenpapieren vorstellen, die allen TeilnehmerInnen des Kurses als Grundlage zur Examensvorbereitung dienen.
Der nachstehend abgedruckte Prüfungskanon für die Staatsexamensklausur Französisch (Teilgebiet Literaturwissenschaft) kommt ab Herbst 2023 zur Anwendung. Garantiert ist, dass mindestens eine der vier zur Auswahl gestellten Aufgaben aus dem Bereich Narrativik/Expositorik stammt; möglich ist allerdings auch, dass entweder aus dem Bereich Lyrik oder dem Bereich Drama tatsächlich keine Aufgabe gestellt wird.
Ausdrücklich sei wie bisher auch schon darauf verwiesen, dass ein und der-/dieselbe Autor/in und dasselbe Werk auch an aufeinanderfolgenden Prüfungsterminen zur Bearbeitung gestellt werden kann.
Folgende Texte (gültig bis einschließlich Frühjahr 2021) können bearbeitet werden:
Bitte besorgen Sie sich die Texte in Buchform und achten Sie bei den älteren Texten auf gut edierte Ausgaben. Internet- und Kindletexte o.Ä. sind nicht verlässlich.
Lehramt Gym.:
Marie de France: Lais (Ausgabe: Ph. Walter [Hg.]: Lais du Moyen Âge. Paris: Gallimard.)
(bei der Prüfung wird als Verständnishilfe eine neufranzösische Übersetzung mit vorgelegt; die Analyse hat am Original zu erfolgen)
Madame de La Fayette: La Princesse de Clèves; Histoire de la Princesse de Montpensier
Laclos: Les Liaisons dangereuses
Flaubert: Madame Bovary
Sarraute: Tropismes; Le planétarium
Ndiaye: Trois femmes puissantes; Quant au riche avenir
LA Realschule:
Flaubert: Madame Bovary
Ndiaye: Trois femmes puissantes; Quant au riche avenir

The course „Risk Management for Financial Institutions" provides students with an overview about the German and international banking sector, the corresponding institutional design as well as fundamental theoretical approaches and related empirical evidence. Core questions are: What is special about banks? Why and how should banks be regulated? How can banks measure and manage (credit) risk?
Lecture (Prof. Florysiak):
Examination:
Students will take a 120-minutes written examination on January 28, 2021, 11:00 - 13:00, online
Retake exam:
Students will take a 120-minutes written retake examination on Jaly 9, 2021, 10:00 - 12:00, online
Veranstaltungszeit: Blockveranstaltung
Montag, 09:00 s.t. – 14:30 s.t. am 11.04.2022
Dienstag, 09:00 s.t. – 14:30 am 12.04.2022
Mittwoch, 09:00 s.t. – 14:30 am 13.04.2022
Donnerstag, 09:00 s.t. – 14:30 am 14.04.2022
Freitag, 09:00 s.t. – 14:30 am 15.04.2022
Einschreibeschlüssel: folgt
Zur Zeit seiner größten Ausdehnung erstreckte sich das russische Zarenreich über 22,7 Millionen Quadratmeter, also einem Sechstel der Erde. Der größte Teil dieses Imperiums befand sich auf dem asiatischen Kontinent und war das Ergebnis russischer Kolonialisierungspolitik. Die Räume, die sich östlich des Ural bis zum Pazifik und südlich bis zu den osmanischen und persischen Imperien erstrecken, werden im Zentrum dieses BK stehen. In den Sitzungen werden wir vergleichend betrachten, wie sie erobert und beherrscht wurden, und analysieren das lokale Leben unter und Proteste gegen die Fremdherrschaft. Dabei widmen wir uns auch übergreifenden Themen wie dem settler colonialism, der Auswirkung von Kolonialismus auf Natur oder der Idee einer "Zivilisierungsmission". Die Teilnehmer*innen erhalten damit nicht nur eine Einführung in die Russische Geschichte, sondern auch in Begriffe und Methoden der aktuellen (Post-)Kolonialismus und Imperienforschung.
Der Basiskurs basiert auf intensiver Diskussion zuhause vorbereiteter Quellen und Texte (auch englischsprachig), sowie einer praxisnahen Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Parallel arbeiten die Teilnehmer*innen an einem eigenen Forschungsprojekt, das in einem Referat präsentiert und in der Hausarbeit verschriftlicht wird.
Literatur zur Einführung: Kappeler, Andreas: Russland als Vielvölkerreich, München 2001; Miller, Chris: We shall be masters. Russian pivots to East Asia from Peter the Great to Putin, Cambridge, MA 2021; Renner, Andreas: Caadaevs zweiter Ellenbogen. Eine „asiatische Wende“ für die Geschichte Russlands, in: Osteuropa 65 (2015), Heft 5-6, S. 1-15.
Prüfungsformen im BA und LA (Studienbeginn bis SOSE 2020): KL+Re+Ha
Prüfungsformen im BA und LA (Studienbeginn ab WISE 2020/21): RE + HA
Prüfungsform im Didaktikfach - Mittelschule und Sonderpädagogik: RE + HA
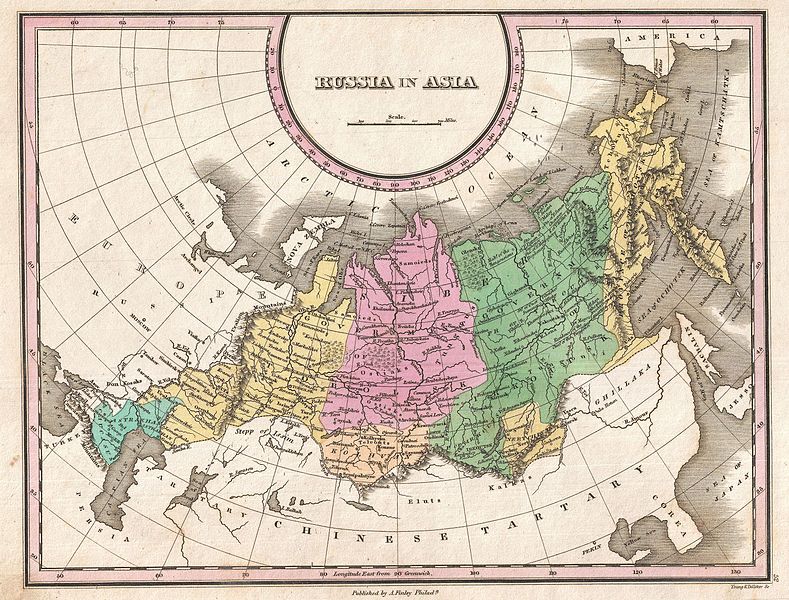
Als Schreib-Peer-Tutor*in können Sie nicht nur Ihre Peers bei ihren Schreibprojekten unterstützen, sondern lernen auch eine ganze Menge darüber, wie Sie selbst beim Schreiben ticken, wie Schreibprozesse funktionieren und wie Sie gezielt schreibend lernen und denken können. In der Schreib-Peer-Tutor*innen-Ausbildung des Schreibzentrums erwerben Sie also nicht nur Kompetenzen, mit denen Sie Peers nach dem Motto der Hilfe zur Selbsthilfe beim wissenschaftlichen Schreiben begleiten können, sondern feilen auch an Ihren eigenen Schreibkompetenzen.

Als Schreib-Peer-Tutor*in können Sie nicht nur Ihre Peers bei ihren Schreibprojekten unterstützen, sondern lernen auch eine ganze Menge darüber, wie Sie selbst beim Schreiben ticken, wie Schreibprozesse funktionieren und wie Sie gezielt schreibend lernen und denken können. In der Schreib-Peer-Tutor*innen-Ausbildung des Schreibzentrums erwerben Sie also nicht nur Kompetenzen, mit denen Sie Peers nach dem Motto der Hilfe zur Selbsthilfe beim wissenschaftlichen Schreiben begleiten können, sondern feilen auch an Ihren eigenen Schreibkompetenzen.

Veranstaltungszeit: wird noch bekannt gegeben
Einschreibeschlüssel: folgt
Prof. Dr. Mathias Habersack auf der Fakultätshomepage
Veranstaltungszeit: wird noch bekannt gegeben
Einschreibeschlüssel: folgt
Prof. Dr. Ulrich Becker, LL.M. (EHI) auf der Fakultätshomepage
Some algorithms from machine learning have successfully approached many of the problems that seemed unsolvable a few decades ago (eg. computer vision, image generation). Irrespective of the successes in applied settings, the learning process, as well as the uncertainties that underlie the learning, remain open problems that challenge the foundations of statistics. Since attempts relying on the traditional (Bayesian and frequentist) frameworks have shown only limited success, some researchers have directed their efforts in questioning the foundations of statistics in a very principled manner (eg. What if there is no data generating process? What if we are not certain about our prior beliefs? Can we talk about a conditional distribution of the parameters without imposing a prior on the parameters? Are all uncertainty dimensions covered?).
In this seminar, we will explore foundations rooted in five main blocks, namely: traditional Bayesian and frequentist frameworks, imprecise probability, decision theory, information theory and compression algorithms. We will build on the following non-exhaustive list of papers:
1. Aleatoric and epistemic uncertainty in machine learning: An introduction to concepts and methods - Hüllermeier, Waegeman (2021)
2. Sources of Uncertainty in Machine Learning--A Statisticians' View - Gruber et al. (2023)
3. Minimum description length revisited - Grünwald and Roos (2020)
4. The Interplay of Bayesian and Frequentist Analysis - Bayarri and Berger (2004)
5. Robust Bayesian Analysis: sensitivity to prior - Berger (1987)
6. All models are wrong, but many are useful: Learning a variable's importance by studying an entire class of prediction models simultaneously - Fisher et al. (2019)
7. Strictly frequentist imprecise probability - Fröhlich et al. (2024)
8. Information-theoretic upper and lower bounds for statistical estimation - Zhang (2006)
9. The E-Posterior - Grünwald (2023)
10. How the game-theoretic foundation for probability resolves the Bayesian vs. frequentist standoff? - Shafer (2020)
11. Judicious Judgement Meets Unsettling Updating: Dilation, Sure Loss and Simpson’s Paradox - Gong and Meng (2021)
12. Testing by betting: A strategy for statistical and scientific communication - Shafer (2019)
We invite students to suggest their own papers that fit within the topic as well.
Who is this seminar for: Motivated students who are open to explore current trends in the foundations of statistics that might provide tools to solve open problems in uncertainty quantification and learning. The seminar is open to master’s students from statistics, mathematics, economics, data science, and similar backgrounds. For students of the Statistics and Data Science program, the seminar can be recognized for the mandatory seminar module in the Methodology & Modeling, Machine Learning and Social Statistics and Data Science tracks, as well as for the additional elective general seminar module ‘Advanced Research Methods in Theoretical Statistics’ (WP 51).
Data Science tracks, as well as for the additional elective general seminar module ‘Advanced Research Methods in Theoretical Statistics’ (WP 51). Requirements for obtaining 9 ECTS credits: Every student has to
* give a 45-60 minutes long presentation on their chosen topic supported by slides and
* write a seminar paper based on it (As a rough guideline: the typical seminar paper is 25-30 pages long; in case the paper is very technical, it can be considerably shorter, which is to be agreed on with the organisers of the seminar). The paper has to be submitted by 01.06.2025 and shall contain a deepened and extended version of the presentation, also taking up the discussion of the presentation and positioning the chosen topic in the context of the seminar. (The registration for the 9 ECTS has to be done via LSF.)
If places are left, we are happy to offer in addition a 3 ECTS version, based on a shorter term paper or presentation. The 3 ECTS could be used flexibly for one of the corresponding generic modules. To apply for the 3 ECTS option write an email to ivan.melev@lmu.de no later than September 25 (no registration via LSF!).
We expect active participation in the discussions of the seminar. This includes a quick personal preparation for each presentation based on some preparation material (1 page) the speakers are asked to provide one week in advance.
What is the format? This is a block seminar in a face-to-face format. It will take place during the week of 26.02.2025-28.02.2025; the exact dates are still to be decided.
Im gegenwärtigen weltanschaulich-religiösen Pluralismus gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher religiöser Gemeinschaften und neureligiöser Bewegungen. Das Seminar beschäftigt sich mit der Entstehung, Lehre und Praxis ausgewählter Gruppen, wie z.B. die Christengemeinschaft, Neuoffenbarer und Neureligionen wie das Universelle Leben oder die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ("Mormonen"). In den Blick kommt auch die Theosophie als "Stammmutter" moderner Esoterik sowie der Neopaganismus (Neue Hexen bzw. Neugermanisches Heidentum)
Es geht um die Entstehungsbedingungen, Grundüberzeugungen und Präsenz dieser Gruppen und Bewegungen in der Gegenwart. Geplant sind Begegnungen mit Vertreter/innen - leider nur per "Zoom". Wenn es die Bedingungen zulassen, ist Anfang 2021 ein Besuch der "YogaWorld"-Messe in München geplant, wo erfahrungsgemäß verschiedene neureligiöse Bewegungen werbend in Erscheinung treten.


Da der vielfältige Einsatz von Bilderbüchern im Unterricht Erfahrungen in Geschichten ermöglicht, die sprachliche Interaktion anregt, Ko-Konstruktion von Vorstellung und Bedeutung aufbaut sowie neben ästhetischer Erfahrung auch eine emotionale Beteiligung erlaubt, bieten Bilderbücher eine Vielzahl an sinnvollen Möglichkeiten für den Spracherwerb. Diese lassen sich besonders innerhalb eines integrativen DaZ-Unterrichts nutzen. In dem Seminar werden hierzu sowohl die theoretischen Grundlagen in den Blick genommen als auch konkrete Praxisbezüge geschaffen. Zu den Schwerpunkten zählt die Wortschatzarbeit mithilfe von Bilderbüchern.
Erwartet wird die regelmäßige & aktive Mitarbeit und das Anfertigen eines Portfolios am Ende des Seminars zum Erwerb der Leistungspunkte.
Das Seminar wird als Online-Seminar (in einer Kombination aus Moodle und Zoom) durchgeführt.
Veranstaltungszeit: wird noch bekannt gegeben
Einschreibeschlüssel: folgt
Prof. Dr. Christoph Knauer auf der Fakultätshomepage
The lecture "Strategic Organization Design" deals with how organizations (e.g. companies) should be designed in order to reach their strategic goals. Building upon the fundamentals of strategic and organizational concepts, the focus of this course is especially the interaction between these two fields of research. Based on individual to company-level analysis, the course will answer questions such as how to design for innovation or how organizations could adapt to a changing environment.
The goal of this lecture is to give students an understanding of the theoretical concepts to answer questions of organizational design and the most important methodological instruments available for analyses including econometric and case-based research methods. At the same time, theoretical concepts will be applied to real-world management questions.
The course divides into a lecture and a subsequent tutorial. The contents of both the lecture and the tutorials are relevant for the exam.
Recorded and asynchronous videos uploaded on LMUCast starting on Monday 18.10.2021 (see the link to LMUCast)
Dies ist der Moodle-Raum zur studentischen Tagung „DaF zwischen Wissenschaft und Praxis“ vom 09.11. - 12.11.2021. Hier werden alle wichtigen Informationen und Dokumente zur Tagung gesammelt, weiterhin bietet der Moodle-Raum Möglichkeit zum Austausch unter den Teilnehmenden.
This
course is centered around software design and systems development. We
explore and apply the concept of object-oriented programming which is
(still) the leading programming paradigm for extensive projects. In
contrast to other programming paradigms like functional or declarative
programming object-oriented programming languages model objects through
their attributes and functionalities. This concept has proven convenient
when modeling real-world problems.
Als „eines der erfolgreichsten Genres des höfischen Sangs“ (Jan Mohr 2021) stellt das Tagelied einen vielschichtigen und durch Variationskunst geprägten Liedtypus des deutschsprachigen Mittelalters dar. Im Zentrum des Seminars werden die Tagelieder des 13. Jahrhunderts u.a. von Wolfram von Eschenbach und Walther von der Vogelweide stehen. Zur Vertiefung werden zudem unterschiedliche Ausformungen des Tagliedsujets in der frühmittelalterlichen romanischen Tradition wie auch der deutschsprachigen spätmittelalterlichen geistigen Lyrik hinzugezogen.
Das Seminar versteht sich als Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und richtet sich gezielt an Studierende, die das Einführungsseminar der Mediävistik absolviert haben und ihre erste Hausarbeit schreiben werden. Willkommen sind auch fortgeschrittene Studierende, die sich für die Methodik des wissenschaftlichen Arbeitens in der deutschen Philologie interessieren und ihre Kenntnisse darin vertiefen möchten.
The "Worlds of Journalism" study was founded in 2010 to assess the state of journalism throughout
the world and is the largest comparative study ever conducted in the history of communication
studies. After a pilot phase (2007-2011) and a second wave conducted in 67 countries (2012-2016),
the data for "WJS 3" (2021-2024) – including survey data from over 32,000 journalists from 75
countries around the globe – has just been finalized. While this dataset remains under embargo
until 2028 for the wider public, in this seminar, you will get the unique chance to have early access
to this “fresh” and extremely rich dataset. Before doing so, we will first look at the goals and the conceptual and methodological background of the study. We may have the possibility to invite
collaborators from across the globe to reflect with us (via Zoom) on the challenges for journalists
and researchers in their respective countries. We will collaboratively decide which theme of WJS
3 we will focus on – e.g., journalists’ safety, editorial freedom, journalistic roles, or influences on
news production. You will then, in small groups, decide on a specific region/country that you are
particularly interested in. After a recap session on basis statistical knowledge, you will then analyze
the data and wrap up your research project in a term paper.
Die deutschsprachige Theaterlandschaft ist einzigartig in ihrer ästhetischen Vielfältigkeit und organisatorischen Komplexität. In dieser Vorlesung sollen daher eine Annäherung an „das“ Theater als Institution und eine Reflexion seiner Bedingungen und Setzungen unternommen werden. Im Mittelpunkt stehen die organisatorischen und inhaltlichen Strukturen verschiedener Theaterformen, die theatergeschichtlichen und kulturpolitischen Kontexte sowie die künstlerischen und technischen Arbeitsprozesse mit ihren zahlreichen Arbeitsbereichen und Berufsbildern. Dabei werden Entstehungsprozesse von Inszenierungen von der Textproduktion bis zur Premiere nachgezeichnet und zwischen verschiedenen Organisationsformen (z. B. Freie Szene, Opernhaus, Stadttheater) verglichen. Die Vorlesung wird dabei im engen Dialog mit Vertreter*innen aus der Theaterpraxis – Dramaturg*innen, Regisseur*innen, Autor*innen, Bühnenbildner*innen, technischer Leiter*innen u. v. m. – stehen. Diese Gäste berichten unmittelbar aus der praktischen Theaterarbeit und geben gleichzeitig Einblick in die Münchener Theaterszene. |
Das Praktikum besteht aus einem Tutorium über Programmierung sowie Programmierumgebungen.
Programmierkonzepte werden anhand von praktischen Beispielen in den Programmiersprachen java, python und bash angewendet und eingeübt. Soweit möglich wird dabei auf für die Bioinformatik relevante Beispiele zurückgegriffen.
Alle Informationen und Materialien finden Sie auf der Fakultätshomepage
Dieses Tutorium richtet sich vor allem an Teilnehmende des Kurses für Klassisches Chinesisch II im Sommersemester 2021. Gemäß den Bedürfnissen und Wünschen der Teilnehmenden werden die im Hauptkurs erlernten Grundlagen für sinologische Arbeit mit Texten in klassischem Chinesisch vertieft, wiederholt und ergänzt.
Kursdetails (Moodle-Einschreibeschlüssel, Zoom-Daten) werden auf Anfrage per E-Mail mitgeteilt.
Kursbeginn: Dienstag, 13.4.2021
Einschreibeschlüssel: aktienrecht
Uhrzeit: Freitag, 14-16 Uhr
Einschreibeschlüssel: TutoriumKieslich2021
Eine Einschreibung ist erst ab Dienstag, 6.4., 12:00 Uhr möglich! Bitte sehen Sie von Anfragen ab.
https://dudle.inf.tu-dresden.de/kXHMytBGjA/ hier bitte anonym abstimmen, wann Ihr die Falllösung übernehmen wollt!
Uhrzeit: Freitag, 14-16 Uhr
Einschreibeschlüssel: TutoriumWimmer2021
Eine Einschreibung ist erst ab Dienstag, 6.4., 12:00 Uhr möglich! Bitte sehen Sie von Anfragen ab.
Herzlich willkommen im Tutorium (Wintersemester 2021/22)!
Begleitend zur Vorlesung "Einführung in die germanistische Linguistik" (Veranstaltungsnummer: 13489) und den Einführungsseminaren bieten euch die Tutorien eine Unterstützung in der Klausurvorbereitung.
Bei Problemen in der Anmeldung meldet euch gerne bei uns!
Wir freuen euch über eure Teilnahme in den Online-Tutorien und die Nutzung der Materialien im Moodle-Kurs!

Das Tutorium richtet sich vornehmlich an Studierende, welche die
Ringvorlesung zur Inszenierungsgeschichte im 20./21. Jahrhundert sowie
eine der Übungen zu Quellenstudien besuchen. Hier werden Inhalte der
Ringvorlesung wiederholt und neu kontextualisiert, um ein tiefergehendes
Verständnis des Lernstoffs zu erlangen.
Im gemeinsamen Dialog fassen
wir die Lernziele zusammen und gehen soweit ins Detail, dass alle
Teilnehmer*innen die Klausurvorbereitung mit einer geordneten Liste an
zentralen Begriffen aus der vorgestellten Theatergeschichte problemlos
angehen können. Dabei sind die Teilnehmer*innen eingeladen, Fragen zu
stellen, Impulse für eine individuelle Schwerpunktsetzung einzubringen
und Diskussionswünsche zu äußern.
Veranstaltungszeit: Dienstags, 12:30 s.t. – 14:00 (ab 19.10.2021)
Einschreibeschlüssel: folgt
Gretchen Liersaph-Turck auf der Fakultätshomepage
Die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und die unvorstellbaren Massenmorde des Holocaust sind zu einem mahnenden und schließlich einenden Moment der Politik Europas geworden. Die Gründung der gemeinsamen Institutionen des Kontinents gehen auf das Vorhaben zurück, solche Kriege in Europa zukünftig zu vermeiden. Gleichzeitig aber sind Gedenken an den Krieg und die damit betriebene Politik in den letzten Jahren immer spannungsreicher in Zentraleuropa geworden. Das wird insbesondere in den Beziehungen einzelner Länder zu Israel deutlich, in denen sich historisches Gedächtnis und Lehren aus der Vergangenheit nicht selten stark unterscheiden. Der Kurs nimmt diese Spannungen und die dahinterstehenden historischen Entwicklungen in den Blick.
Im Mittelpunkt stehen die diplomatischen Beziehungen Deutschlands, Tschechiens und Polens zu Israel. Alle drei Länder betonen den besonderen Status ihrer Beziehungen zum jüdischen Staat, ein Fakt der sich in den verschiedenen Außenpolitiken widerspiegelt. Im Kurs werden wir diese analysieren und vergleichen sowie deren Auswirkungen auf EU-Politik behandeln.
Die Übung wird in Zusammenarbeit mit Dr. Irena Kalhousová (Karls-Universität in Prag) und Prof. Dr. Joanna Dyduch (Jagiellonen-Universität Krakau) angeboten und bringt jeweils acht Studierende der drei Universitäten zusammen. Die regelmäßigen Sitzungen finden über Zoom statt. Unterrichtsprache ist Englisch. Als Prüfungsleistung ist die Erstellung eines Audiopodcasts in tri-nationalen Kleingruppen geplant. Darüber hinaus ist für den 11.-14.11.21 ein Treffen der TeilnehmerInnen in Krakau geplant (wenn es die Gesundheitszulage zulässt). Die Selbstbeteiligung für die Exkursion beträgt 100 Euro.
Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis zum 30.8.2021 notwendig. Bitte senden Sie bis zu diesem Datum eine Email mit einer kurzen Begründung zu Ihrem Interesse an der Übung an daniel.mahla@lmu.de. Alle, die sich anmelden, erhalten wenige Tage später Bescheid, ob Sie in den Kurs aufgenommen werden konnten.
Literatur zur Vorbereitung:
Bachleitner, Kathrin. 2019. ‘Diplomacy with Memory: How the Past is Employed for Future Foreign Policy’. Foreign Policy Analysis 15: 492-508.
Malgorzata Pakier: A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance, New York 2012.
Online-Veranstaltung.
Prüfungsform im BA und mod. LA: ES
P 14.1: Vertiefungsseminar Lateinische Literatur
Gruppe 01: Livius, Ab urbe condita I
Dozentin: Prof. Dr. Therese Fuhrer
Mi 10-12 Uhr
Erste Sitzung: 4. November 2020
Letzte Sitzung (voraussichtlich): 10. Februar 2021
Ziele und Schwerpunkte: Wir lesen in diesem Semester (12 Wochen) die Praefatio und das ganze erste Buch von Livius’ Ab urbe condita. In Kurzreferaten werden zudem übergreifende Themen behandelt (Livius und historischer Kontext, Textüberlieferung, Gattungstradition der Annalen, Etrurien und Rom in der Ur- und Frühgeschichte, archäologische Befunde, Tradition der Gründungsmythen, Rolle der Frauenfiguren, Tyrannenmorde, Grundlagen der Erzähltheorie, Nachwirkung der livianischen ‘Geschichten’, u.a.).
Methode und Leistungsausweis: Nach einer Einleitungssitzung werden wir unter der Leitung der Teilnehmer*innen die Praefatio und das ganze erste Buch abschnittsweise lesen, teils den lat. Text mit detaillierter Einzelanalyse von Sprache und Form, teils in dt. Übersetzung, immer mit Blick auf die Frage nach Aufbau und Erzähllogik.
Zum Leistungsausweis gehören die gründliche Vorbereitung, die Übernahme einer Sitzungsleitung, ein Kurzreferat und die aktive Teilnahme an jeder Sitzung.
Für die Sitzungsleitung ist eine kommentierte schriftliche Übersetzung der jeweils folgenden Textpassage vorzubereiten, die eine Woche vor dem Termin der Sitzungsleitung abgegeben wird. Die Besprechung findet im Rahmen der seminarbegleitenden Übung (P 14.2) statt; den Termin sprechen Sie mit Prof. Fuhrer individuell ab.
Ein Programm mit den Textstellen und dem Plan für die Sitzungsleitungen ist rechtzeitig vor Semesterbeginn im Dateidepot zu finden. Interessent*innen für bestimmte Sitzungsleitungen/Termine und Kurzreferate (nicht am selben Termin) melden sich bei Prof. Fuhrer per Mail (t.fuhrer@lmu.de).
Die Hausarbeit soll die Interpretation des ganzen Texts von Ab urbe condita I ins Zentrum stellen, mit Blick auf die Frage nach der Funktion der Textstellen, die in der Sitzungsleitung erarbeitet wurden, in Struktur und Gedankengang der Erzählung des ganzen Buches.
Kritische Textausgabe (obligatorisch): Titi Livi Ab urbe condita, tomus I: libri I-V, ed. R.M. Ogilvie (Oxford 1974). Ein Reader wird im LSF Dateidepot zur Verfügung gestellt.
Literatur zur Vorbereitung:. J.D. Chaplin/C.S. Kraus (Hgg.), Oxford Readings in Classical Studies: Livy (Oxford 2009), darin: “Introduction”, Ss. 1-14.
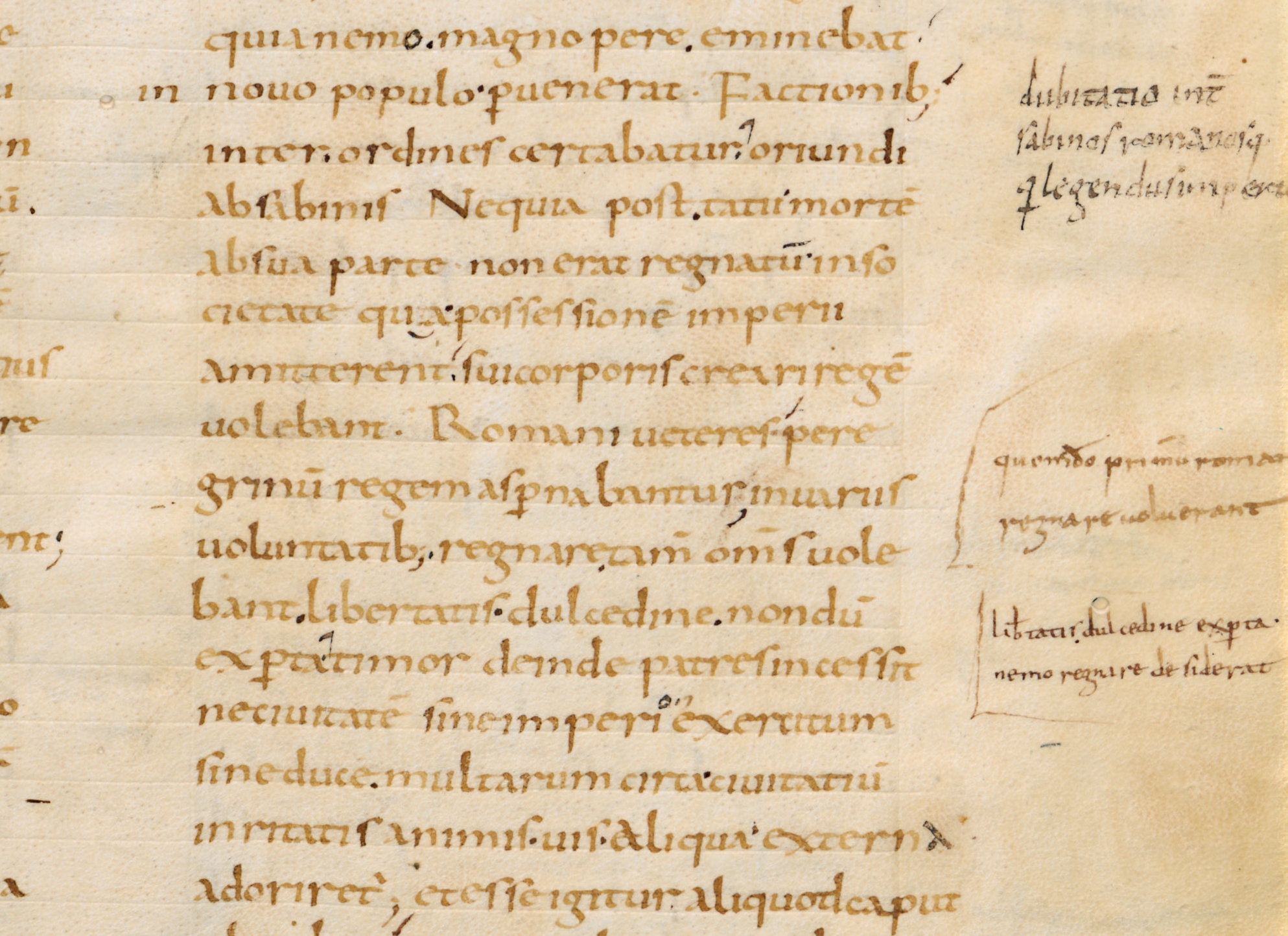
Ziele und Schwerpunkte: Mit den beiden Büchern, mit denen Vergil die Aeneis beginnen bzw. enden lässt, wird zum
einen die Erzählung von Aeneas’ ‘Irrfahrt’ eingeleitet (Buch 1) bzw. vom ‘Krieg
in Latium’ bis zum entscheidenden Ereignis, Aeneas’ Sieg im Zweikampf gegen
Turnus, geführt (Buch 12). Zum anderen werden in den beiden Büchern die ‒ für
das ganze Epos relevanten ‒ umfassenderen Fragen nach der Rolle des Fatums und
göttlicher Mache sowie der Bedeutung von Schuld, Verantwortung und
Emotionalität prominent gestellt und diskutiert. Exemplarisch seien die
Jupiter-Rede in Aeneis 1 und die Tötung des Turnus in Aeneis
12 genannt. Dabei wollen wir auch die Frage stellen, inwiefern in Vergils Aeneis auch (zeitgenössische)
philosophische Diskurse reflektiert werden.
Im Zentrum stehen die Lektüre, Analyse und Interpretation des lat. Textes (ergänzend dazu die Lektüre von Passagen in dt. Übersetzung).
In Kurzreferaten werden übergreifende Themen behandelt (zur Biographie Vergils, antike Vergil-Viten, Textüberlieferung, historischer Kontext, augusteische Kulturpolitik, der Troja-Mythos in Rom, das augusteische Karthago, Aeneas in Latium, Rezeptions-Traditionen, Aeneas in der modernen Forschung u.a.).
Methode und Leistungsausweis: In den einzelnen Sitzungsleitungen, die von den Studierenden übernommen werden, werden ausgewählte Textpartien gelesen und diskutiert. Zum Leistungsausweis gehören die gründliche Vorbereitung, eine Sitzungsleitung, ein Kurzreferat und die aktive Teilnahme sowie mündliche Prüfung. Für die Sitzungsleitung ist eine schriftliche Übersetzung einer ausgewählten Textpassage vorzubereiten, die eine Woche vorher abgegeben wird und mit Prof. Fuhrer mind. 2-3 Tage vor der Sitzung besprochen wird.
Der Stoff des Seminars ist in Modul 12 Gegenstand
der mündlichen Prüfung (30 Min.). Es wird empfohlen, die Vertiefungsvorlesung
"Römische Philosophie" im selben Modul zu besuchen und das Modul mit einer mündlichen Prüfung zusammen abzuschließen (in einer Prüfung von 60 Min.).
Kritische Textausgabe (obligatorisch):
P. Vergili Maronis Opera, ed. R.A.B. Mynors (Oxford 1969, repr. corr. 1972 bzw. neuere Nachdrucke).
Ein Reader mit Scans der Bücher 1 und 12 wird zur Verfügung gestellt. Andere Ausgaben sind nicht zugelassen
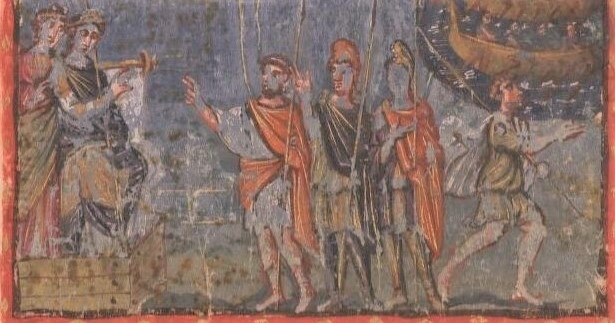
„Philosophie in Rom“ ist eine Überblicksvorlesung zu einem zentralen Gegenstand der lateinischen Literaturgeschichte. Anhand von Texten Ciceros, Lukrez’ und Senecas sollen die Thesen der einflussreichsten Philosophenschulen behandelt werden (Stoa, Epikureismus, skeptische Akademie). Den Abschluss soll ein Ausblick auf die römische platonische Tradition (Apuleius, Augustin) und christliche Rezeption bilden (Augustin und Boethius).
Texte (Handouts) werden verschickt bzw. in Moodle eingestellt.
Der Stoff ist in Modul 12 Gegenstand der mündlichen Prüfung (30 Min.).
Literatur zur Vorbereitung: G. Maurach, Geschichte der römischen Philosophie. Eine Einführung (Darmstadt 21997).
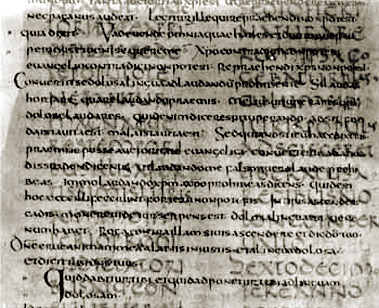
Veranstaltungszeit: Fr., 08–10 Uhr c.t. (ab 22.10.2021)
Einschreibeschlüssel: folgt
Die Vorlesung „Virtual Reality“ wird Theorie sowie grundlegende praktische Erfahrungen bei der Entwicklung von interaktiven und immersiven Anwendungen für professionelle VR-Installationen (z. B. CAVE) und Head-Mounted Displays (HMDs) vermitteln. Der Inhalt umfasst theoretische Grundlagen zu den Bereichen MR und speziell VR sowie die Vermittlung von Kenntnissen für alle Entwicklungsschritte von der Konzeption einer Projektidee bis hin zur fertigen Anwendung.
Die Anmeldung wird über Uni2Work stattfinden und ist von 1.10.2021 bis 14.10.2021 möglich! Plätze werden ehestmöglich nach dem 15.10. vergeben, akzeptierten Teilnehmern wird der Einschreibeschlüssel für Moodle übermittelt.
Die Vorlesung soll Dienstags von 13:00 - 16:00 stattfinden, der erste Termin ist der 19.10.2021!
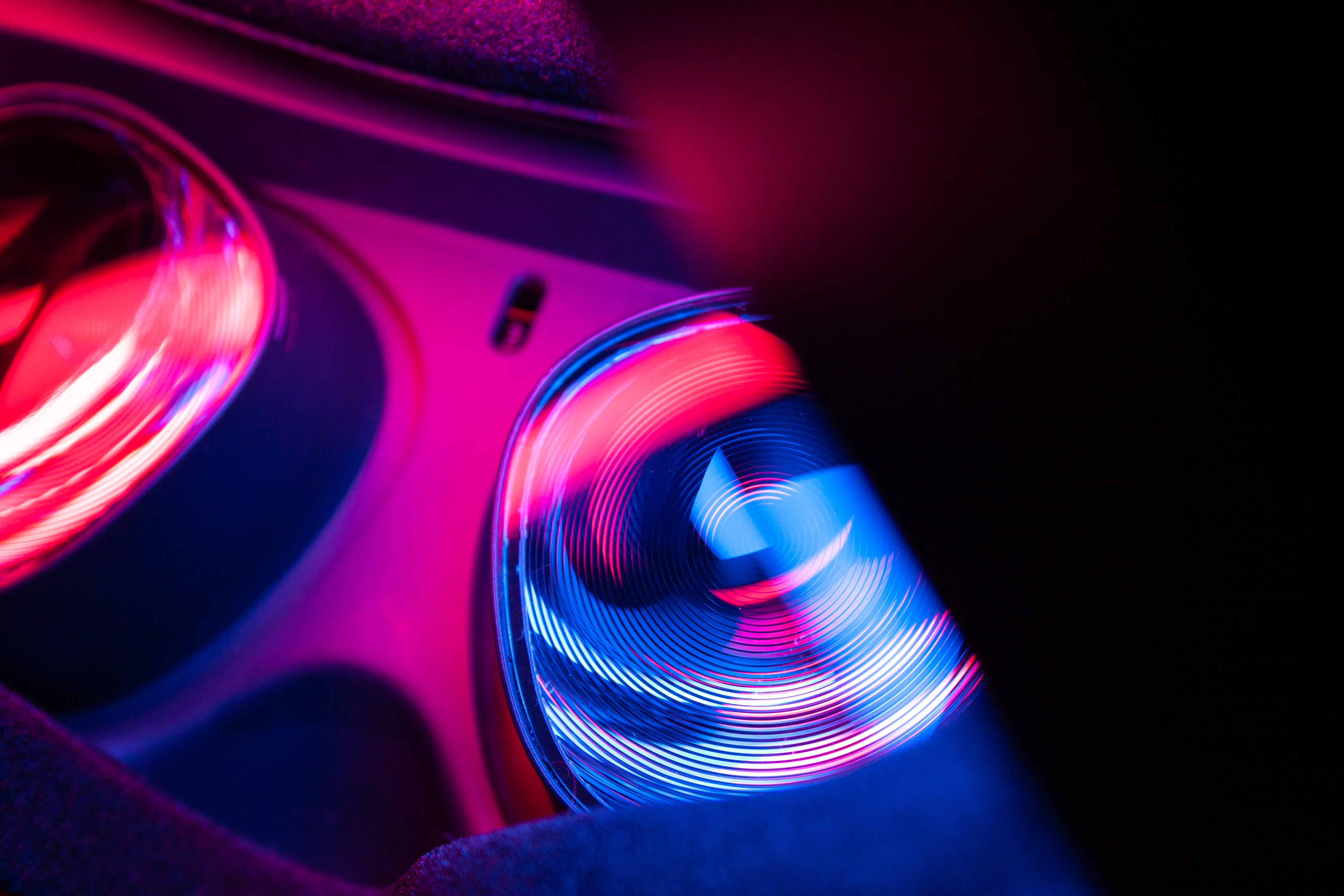
Für das Theater sind in den letzten Jahren vielfältige ,Krisen‘ ausgerufen worden: Vertreter:innen der Wissenschaft und des Feuilleton beklagen neben einem ,Publikumsschwund‘ auch eine ,Legitimationskrise‘ des Theaters. In diesem Kontext rückt insbesondere auch die Zeit seit den temporären Theaterschließungen in den Jahren 2020 und 2021 in den Fokus: Wie sind Theater damit umgegangen, dass das Publikum nicht kommen konnte? Welche (neuen) Formate haben sie entwickelt? Welche Auswirkungen haben neue, teils digitale Produktions- und Rezeptionsweisen hinsichtlich der Erwartungsstrukturen an Theater und an seine künstlerischen Angebote? Dabei taucht nicht zuletzt die Frage auf, welche Rolle das Publikum für die Programmgestaltung wie auch für das Selbstverständnis des Theaters als Institution hat.
Im Seminar werden Rezeptions- und Wirkungsfelder der performativen Künste mit einem Schwerpunkt auf die öffentlich getragenen Theater untersucht. Der Einbezug der freien Szene ist ebenfalls willkommen. Neben der Vermittlung von theoretischen Grundlagen werden Methoden der Publikums- und Rezeptionsforschung an konkreten Beispielen angewendet. Basis für die kursbegleitenden Projekte bilden empirische Methoden (z.B. Interview, Beobachtung, Umfrage) oder/und textbezogene Methoden (z.B. Dokumenten-, Diskursanalyse).

Die Vortragsreihe „Ostmitteleuropa denken“ bietet der Elitestudiengang Osteuropastudien der LMU München in Zusammenarbeit mit der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität Prag an. Die Lehrveranstaltung findet im Rahmen eines geplanten Double-Degree-Programms der beiden Einrichtungen statt. Die Reihe ermöglicht es den Studierenden, einen Einblick in die neuzeitliche Sozial- und Kulturgeschichte nicht nur der böhmischen Länder zu erlangen und zentrale Themen der Identitätsbildung in diesem Teil Europas im 19. und 20. Jahrhundert zu diskutieren. Die ersten Vorträge führen in die multiethnische Lebenswelt der späten Habsburgermonarchie ein, in der sich allmählich nationale und politische Gesellschaften ausbildeten, die die eigene moderne Staatlichkeit anstrebten. Das Grundmotiv der Vorträge über die Zwischenkriegszeit und das erste Jahrzehnt nach dem 2. Weltkrieg bilden die Themen Ethnizität und Nationalismus. Daran anschließend beschäftigen sich die Vortragenden insbesondere mit dem Charakter, der Legitimität und den Krisen des Staatssozialismus. Abgeschlossen wird der Zyklus durch zwei Vorträge zur Entstehung und Rolle der älteren Geschichte und Literatur bei der Ausformung moderner Identitäten in den böhmischen Ländern und Ungarn.

In unseren vier Seminarblöcken werden wir Auszüge aus Werken unterschiedlicher Prosa-Genres übersetzen: aus Kate Briggs‘ essayistisch-lyrischem Roman The Long Form (ab September in meiner Übersetzung bei Nagel & Kimche), aus ihrem literarischen Essay This Little Art (2021 in meiner Übersetzung bei Ink Press erschienen), aus Anton Van Iersels klassisch erzähltem (noch unübersetzten) Roman No Noble Escape sowie experimentelle Kurzprosa aus Buddhaditya Chattopadhyays The Nomadic Listener (auszugsweise und in meiner Übersetzung 2023 in der Literaturzeitschrift Sprache im technischen Zeitalter erschienen). Mit diesen unterschiedlichen stilistischen Herausforderungen wollen wir unsere handwerklichen und sprachschöpferischen Fähigkeiten gleichermaßen trainieren. Ich freue mich auf eine anregende Werkstatt, wo natürlich auch Raum sein wird für Ihre berufspraktischen Fragen.

Aufbauend auf den Techniken aus Modul 2 soll das Vorgehen der DBT-PTBS vermittelt werden. Hierzu gehören folgende Aspekte: Erstellung einer Behandlungsplanung und Behandlungshierarchie unter besonderer Berücksichtigung von Suizidalität, Selbstverletzung, Substanzmissbrauch, Ess-Brech-Anfällen und anderen problematischen Verhaltensweisen; Erarbeitung von Techniken zur Behandlung von dysfunktionalen Verhaltensweisen, Etablierung von Alternativstrategien, Verbesserung der Emotionsregulation und der interpersonellen Fertigkeiten; Psychoedukation und Behandlung von Dissoziation; Erarbeitungen von Voraussetzungen für traumafokussierte Interventionen; Indikation und Kontraindikation für das imaginative Nacherleben; Durchführung des imaginativen Nacherlebens unter Berücksichtigung dissoziativer Symptome.
Darüber hinaus wird auf die Erstellung eines Behandlungsleitfadens für Patient*innen mit hoher Dissoziationsneigung eingegangen.
In verschiedenen Psalmen finden sich theologisch deutende Rückblicke auf die Geschichte Israels. Als Geschichtspsalmen gelten insbesondere Ps 77–78; 105–106; 114; 135–136. Durch die erinnernde Vergegenwärtigung der Geschichte kann sich jede neue Generation des Gottesvolkes ihrer Identität vergewissern. Welche „Ereignisse“ erinnert werde und wo sich Leerstellen finden, mag aber überraschen.
Das Alte Testament bildet ein wichtiges Fundament des christlichen Glaubens. Grundkenntnisse über Entstehung und Inhalt der alttestamentlichen Schriften sind deshalb unabdingbar. Die Übung gibt Einblicke in die fachwissenschaftliche Methodik und vermittelt einen Überblick über Inhalt sowie zentrale theologische Aussagen ausgewählter alttestamentlicher Schriften. Die SeminarteilnehmerInnen sollen so zu einem vertieften Verständnis des Alten Testaments gelangen und Wege zu einem inhaltlich fundierten Umgang mit alttestamentlichen Texten erarbeiten.
Sources are the foundations of historical understanding: they open
windows onto the past that allow historians to reconstruct and
re-interpret events, personalities, and broader dynamics. This course
aims to introduce students to this study through a diverse selection of
published and unpublished material: this not only includes charter,
diplomatic and chronicle material (in both Latin and the vernacular),
but also architectural and artistic evidence from across medieval
England, France, Germany, Italy and the wider Mediterranean. Students
will learn about different methods of source evaluation and consider how
this evidence can be used to modify historical understanding. Moreover,
students will also reflect on archival practises: this will not only
involve an investigation of archives between the medieval and modern
periods, but also look to future methodologies such as digital
preservation, digital editions, and digital mapping. In doing so,
students will develop transferable skills of critical analysis and
reflection, and refine their abilities to use historical sources to
construct historical narratives and arguments.
Ist es „strategische“ Prozessführung, wenn ein peruanischer Bauer einen deutschen Energiekonzern vor deutschen Gerichten klagt? Oder wenn von einer Diskriminierung Betroffene während eines Gerichtsverfahrens die Unterstützung und Expertise einer NGO einholen? Wenn Umweltschutzorganisationen Staaten wegen mangelnder Klimabemühungen „verklagen“?
Was ist eigentlich „strategische Prozessführung“, und: ändert die Einordnung als „strategische Prozessführung“ etwas an der rechtlichen Beurteilung der jeweiligen Ansprüche und an ihrer Legitimität? Was unterscheidet strategische Prozessführung von „normalen“ Gerichtsverfahren? Ist strategische Prozessführung in Deutschland erlaubt? Wann ist sie erfolgreich?
Diesen und vielen anderen Fragen widmen wir uns im Rahmen der Vorlesung „Strategische Prozessführung“.
Der Vorlesung liegt ein interaktives, diskursives Konzept zu Grunde. Auf Basis kurzer Inputs der Lehrveranstaltungsleiterin zu Theorie und Praxis der strategischen Prozessführung werden die jeweils maßgeblichen Fragen in der Gruppe erörtert. Studierende sollen sich mit ihren persönlichen Erfahrungen und Wissensstand einbringen um gemeinsames Lernen und Reflektieren zu ermöglichen. Zu jedem Workshop werden Expert:innen aus der Praxis der Strategischen Prozessführung eingeladen, die mittels eines kurzen Statements einen Einblick in ihre Tätigkeit geben, um anschließend Fragen und Überlegungen zu diskutieren, die im Workshop zuvor gemeinsam erarbeitet wurden. Dadurch soll den Studierenden die Möglichkeit geboten werden, eine Vorstellung von der Praxis strategischer Prozessführung und möglichen Tätigkeitsfeldern zu bekommen.
Eine Vorbereitung auf die einzelnen Einheiten ist nicht unbedingt erforderlich, allerdings ist die aktive Mitarbeit der Studierenden Voraussetzung für das Gelingen der Lehrveranstaltung.
Abhaltung: 4x, wöchentlich, ab Donnerstag den 17.2.2022, von 14:00 bis 18:00, HS A014, Geschwister-Scholl-Platz 1 (im Bedarfsfall online via Zoom)
Veranstaltungszeit: wird noch bekannt gegeben
Einschreibeschlüssel: folgt
Prof. Dr. Hans-Georg Hermann auf der Fakultätshomepage